![[Kalkutta, Howra-Brücke über den Hugli]](howrabridge.jpg)
![[San Francisco, Golden Gate Bridge]](ggbridge.jpg)
INDIEN IST NICHT AMERIKA
![[Kalkutta, Howra-Brücke über den Hugli]](howrabridge.jpg)
![[San Francisco, Golden Gate Bridge]](ggbridge.jpg)
Fortsetzung von Teil II
Aufmerksamen Lesern von Dikigoros Reisen durch die Vergangenheit ist sicher längst aufgefallen, daß er bei seiner Reise ins Garhwal nicht nur ein paar Jahre voraus gegriffen hat, sondern bis fast in die Gegenwart gesprungen ist - aber er hatte ja schon geschrieben, daß dies keine Chronologie seiner Indienreisen ist, sondern ein Querschnitt, der eher thematisch geordnet ist; und da er schon beim Ganges war, wollte er erstmal dabei bleiben, auch wenn er zu dessen Quellen erst ganz zuletzt vorgestoßen ist, Jahre nachdem er in Warānsī und Jahrzehnte nachdem er zum ersten Mal in Kålkattā war. Chronologisch besuchte Dikigoros nach Warānsī - wie einst Melone - Kajurāho. Es ist (oder war jedenfalls damals noch) ein idyllisches Städtchen, nein ein Dorf; privater Autoverkehr ist verboten (Dikigoros schafft es trotzdem irgendwie, ein Kurierdienst nimmt ihn und zwei polnische Pärchen, die auch keine Lust haben, noch länger auf den Bus zu warten, gegen einen kleinen Aufpreis mit), Bahnanschluß gibt es nicht, und der kleine Flughafen ist einstweilen still gelegt, denn es ist keine Saison. Die Hotels sind leer, die meisten Restaurants haben geschlossen, kurzum, Dikigoros hat das Städtchen fast für sich alleine, denn die Polen klappern nur einmal kurz die westlichen Tempel ab und fahren dann gleich weiter - wer weiß, wann der nächste Kurier-Jeep hier vorbei kommt! Die weniger populären, da weit verstreuten Ruinenfelder im Osten besucht sowieso kaum jemand - Dikigoros läßt sich von einem jungen Einheimischen führten, der ihm auch gleich das einzige Restaurant am Ort empfiehlt, wo es Spaghetti und Maccaroni arrabiate gibt. (Der Inhaber hat - wie der Staatschef - eine Italienerin geheiratet, die Dikigoros freilich nie zu Gesicht bekommt, obwohl er ein guter Kunde ist: er bestellt immer gleich zwei Portionen, weil die so knapp bemessen sind - ein Ort für Gourmets und Gourmands ist Khajurāho nicht.) Die Tempel im Westen sind eingezäunt, der Eintritt kostet 1 Rp. [5 Pf], incl. Museum (ob sich das amortisiert?), bis auf einen kleineren ganz vorne links, der kostet nichts, aber er ist auch nicht "echt", sondern dient zur Abzocke auswärtiger Touristen: Wer sich hinein traut, wird gleich mit offenen Armen und Händen empfangen, man versucht, ihm einen Blumenkranz à la Hawaii umzulegen, und wenn man will, kann man sich vom "Pandit" ganz privat eine Pūjā inszenieren lassen. So ein Affentheater, denkt Dikigoros - ja, diese Tierchen gibt es hier auch; sie kraxeln auf den Tempeln herum, zusammen mit muslimischen Touristen, die noch nie die Abbildung einer nackten Frau aus der Nähe gesehen zu haben scheinen, denn sie sind ersichtlich nur deshalb gekommen. Wenn sie das Freilicht-Museum wieder verlassen, werden sie am Ausgang schon erwartet, von halbwüchsigen Knaben mit schmuddeligen Ansichtskarten mittelprächtiger Schärfe und Farbqualität, die "Kamasutra" betitelt sind; aber sie passen überhaupt nicht zu den Tempeln: Deren Erbauer hatten im 11. und 12. Jahrhundert ein ganz anderes Frauen-Ideal: hoch gewachsen in Saft und Kraft, schlank, aber nicht zu dünn, große, pralle Brüste (manchmal könnte man meinen, daß die damals schon Silikon gekannt hätten!), sauber epiliert und allenfalls mit einem schmalen Gürtel bekleidet, zeigen die Reliefs sie in mehr oder weniger pikanten, oft sportlich-artistischen Posen und beim "Mithun" [Geschlechtsverkehr in allen seinen Spielarten]. Die Bilder dagegen stammen aus der dekadenten Muģal-Zeit: schräge Klappergestelle, immer halb bekleidet, auch beim Sex (meist mit dunkelhäutigen, häßlichen Arabern in unbequemen, überhaupt nicht anregenden Stellungen), so richtig was zum Abgewöhnen...


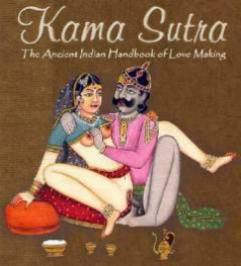
Am nächsten Morgen steht Dikigoros früh auf - es ist irgendein Feiertag - und geht wieder in die Tempelanlage. Einheimische Frauen machen Pūjā, d.h. sie bekleckern einen Shiw-Ling mit duftendem Öl und streuen Blüten auf den Fußboden davor. "Halt, hier dürfen Sie nicht sein," behauptet ein vergammelter Pandit, der plötzlich aus einer dunklen Ecke auftaucht, "das ist nur für Frauen". - "Wieso? Du bist doch auch ein Mann?!" Der Pandit verzieht sich unter Protest, und Dikigoros bleibt, was die Damenwelt zwar sichtlich ablenkt, aber außer ein paar kichernden Blicken lassen sie sich nicht in ihren Zeremonien stören - die zwar nur einfach, fast primitiv sind, aber dafür "echt"! A propos echt: Während der Saison besteht Khajurāho wohl überwiegend aus zugereisten Händlern von Kashmīr bis Kanyākumārī, die den Touristen ihren Kram andrehen wollen. Jetzt sind die meisten Geschäfte geschlossen; in eines der wenigen, die noch auf haben, läßt sich Dikigoros auf einen Tee einladen. Man führt ihm mehr oder weniger erlesene Seidenstoffe und Tücher vor, Schmuck, Nippes usw. - er lehnt alles dankend ab. "Aber irgend etwas müssen Sie doch kaufen," meint der Inhaber verzweifelt. "Nahīn, wieso? Wenn ich etwas kaufen würde, müßte ich es mit mir herum schleppen, und das ist mir zu anstrengend." - "Aber wir verschicken es, gut verpackt und versichert, gegen einen geringen Aufpreis bis zu Ihnen nach Hause." - "Nein." - "Wir könnten Ihnen echte Silbermünzen aus der Gegend hier besorgen, sehr günstig, in jeder beliebigen Menge." - "Wer sagt mir, daß die echt sind?" - "Ich. Die werden seit Jahrhunderten nach derselben Methode geschlagen, und wenn die Stempel abgenutzt sind, werden neue angefertigt, nach alter Tradition; die heutigen sind so echt wie die aus dem 12. Jahrhundert." Dikigoros lächelt: "So kann man es auch sehen. Aber wozu machen Sie das überhaupt? Gibt es denn so viele Touristen, daß sich das lohnt?" - "Wieso Touristen? Die werden für den einheimischen Bedarf hergestellt; Sie glauben doch nicht, daß sich eine Frau das Falschgeld der heutigen Regierung aus Blech und Papier um den Hals hängen will, wenn sie heiratet?! Wir prägen echtes Geld aus echtem Silber."
Exkurs. Das erinnert Dikigoros an ein Gespräch, das er mal mit einem Uhrenhändler in Singapur führte, der ihm partout ein Markenuhren-Imitat andrehen wollte. Dikigoros war überhaupt nicht interessiert; aber der Händler glaubte ihm das nicht (denn er hatte zuvor beobachtet, daß Dikigoros einige Raubkopien von Musik-Kassetten gekauft hatte - übrigens in vorzüglicher Qualität; die Dinger halten heute noch, nach über 30 Jahren, und klingen einwandfrei, obwohl sie spottbillig waren, während all die "Original"-Kassetten und die selber bespielten - wohlgemerkt so genannte "Qualitäts-Ware" - längst zu Bandsalat geworden sind oder nur noch ein trauriges Rauschen von sich geben) und ging deshalb immer weiter mit dem Preis herunter, bis er wirklich lächerlich niedrig war. "Sie wollen mir doch nicht weis machen, daß Sie zu diesem Preis echte Uhren verkaufen können?!?" sagt Dikigoros schließlich, "das ist doch Betrug!" - "Aber entschuldigen Sie, selbstverständlich sind das echte Uhren, die gehen ebenso exakt wie jede andere." - "Das meine ich nicht; die sind doch nicht wirklich von dem Hersteller, der drauf steht, sondern aus Hongkong oder sonstwo!" - "Sie verstehen offenbar nicht viel von Uhren. Was glauben Sie denn, wo Rolex, Gucci usw. ihre Uhren herstellen lassen? Natürlich auch in Hongkong; dies ist Überschußware, die heimlich in nächtlichen Extraschichten hergestellt worden ist." - "Also illegal." - "Aber in gleicher Qualität, das dürfen Sie mir gerne glauben." - "Und der Preis? Da können Sie doch gar nichts mehr dran verdienen - oder haben Sie die gestohlen?" - "Glauben Sie etwa, ich reise extra nach Hongkong, um dort Uhren zu stehlen?" - "Wenn nicht persönlich, dann sind Sie vielleicht ein Hehler." - "Ihr Ausländer seid immer so mißtrauisch. Nicht wir sind die Kriminellen, sondern Ihre großen Konzerne. Sehen Sie, Rolex läßt seine Uhren in Asien für ein paar Dollars herstellen und verkauft sie dann mit seinem Namenszug für viele tausende weiter, weil irgendwelche Idioten glauben, die wären made in Switzerland. Ich dagegen schlage Ihnen nur die übliche Gewinnmarge auf, die ich brauche, damit ich und meine Lieferanten überleben können. Wer sind nun die Betrüger?" Dikigoros versteht tatsächlich nicht viel von Uhren, deshalb bricht er das Gespräch an dieser Stelle ab - ohne eine Uhr gekauft zu haben; aber wenn das, was der Händler ihm da erzählt hat stimmt, dann gibt es wohl mehrere Betrüger: ein paar kleine, die damit auf der Straße ein paar Dollars verdienen und dafür riskieren, als Kriminelle verhaftet und eingesperrt zu werden; und ein paar große, die damit ganz "legal" Millionen scheffeln und dafür in aller Welt einen guten Namen genießen. Dikigoros besitzt übrigens eine jener "echten" Markenuhren, einen "Chronographe suisse" aus den 1950er Jahren - ein Erbstück von seinem Vater. (Nicht, daß der sich damals hätte leisten können, so etwas von seinem schmalen Beamtengehalt zum regulären Preis zu kaufen; aber er hatte sie bei einer Versteigerung beschlagnahmter Schmuggelware billig erworben - einen Vorteil mußte es ja haben, beim Zoll zu arbeiten. Heutzutage wäre das nicht mehr möglich, weil keine "echten" Uhren mehr geschmuggelt werden, sondern nur noch "gefälschte" - aber das ist eine andere Geschichte :-) Der sieht zwar gut aus, aber er geht jeden Tag penetrant eine Minute vor - das würde einer batteriegetriebenen Kopie wahrscheinlich nicht passieren. Exkurs Ende.
Zurück nach Indien. "Ach so, ja, bei Ihnen muß die Braut ja noch eine riesige Aussteuer mit in die Ehe bringen," sagt Dikigoros, "sonst wird sie zum Ladenhüter, wie all Ihre hübschen Sächelchen hier." Der Laden ist - bis auf Mitarbeiter und "Touts" [HiWis zum Einfangen vermeintlicher Kauf-Interessenten] - leer, also haben sie Muße, etwas ausgiebiger über dieses Thema zu diskutieren. "Was ist daran eigentlich schlecht?" fragt der Inhaber, "finden Sie es besser, wenn der Mann sich eine Braut kauft, wie in Afrika oder in Thailand, und sie dann behandelt wie ein Stück Vieh?" - "Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun," meint Dikigoros, "die Erfahrung spricht sogar dafür, daß man sein Eigentum pfleglicher behandelt als etwas, das einem nicht gehört. Man liest und hört doch immer wieder, daß indische Männer ihre Frauen umbringen - oder von der Schwiegermutter umbringen lassen - wenn die Mitgift ihnen nicht hoch genug ist; erst vor ein paar Tagen las ich wieder in der Zeitung..." - "Was schließen Sie denn daraus, daß solche Fälle in die Schlagzeilen kommen? Daß es Gang und Gäbe ist? Dann würden unsere Journalisten doch kein Wort darüber verlieren! Gerade weil das so außergewöhnlich und unerhört ist, macht es Skandal; das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Gibt es denn bei Ihnen im Westen gar keine Gewalt in der Ehe und keine Morde?" - "Na ja..." - "Sehen Sie, bei Ihnen gibt es doch auch so etwas wie Mitgift, oder?" - "Ja, aber sie nimmt nicht derartige Ausmaße an, daß sich die Eltern, und mitunter die ganze Familie auf Jahrzehnte hinaus hoffnungslos verschulden müssen." - "Was hat Ihre Frau als Aussteuer bekommen?" - "Einen Herd, eine Waschmaschine und eine Ausbildung an der Universität; und mein Schwiegervater hat die Hochzeitsfeier bezahlt." - "Was hat das zusammen gekostet?" - "Sie würden es für viel halten, wenn ich es in Rupyen umrechne; aber für ihn war es vielleicht ein Brutto-Monatsgehalt als Lehrer." - "Was hat die Ausbildung Ihrer Frau gekostet?" - "Unsere Universitäten erheben keine Studien-Gebühren." [Damals, liebe jüngere Leser, war das noch generell so, Anm. Dikigoros] - "Aber Sie müssen doch Unterkunft und Verpflegung während des Studiums bezahlen und die Lehrmittel; und Sie müssen den Verdienstausfall berücksichtigen in der Zeit, die mit studieren vertan wird; und daß die Frau dabei ihre besten Jahre zum Heiraten und Kinderkriegen verliert, kann man gar nicht in Geld ausdrücken." - "In der Regel verdienen Akademikerinnen mehr als andere; das Geld für die Ausbildung kommt also wieder herein." - "In der Regel? Was heißt das? Ist Ihre Frau in ihrem studierten Beruf tätig und verdient sie da so viel?" - "Äh..." - "Also nein. Wie man mir erzählt hat, geht es sehr vielen Frauen im Westen so, weil es gar nicht genug Jobs für Akademikerinnen gibt, und die sind sehr unzufrieden mit ihrem Leben. Hat es sich also gelohnt?"
"Es gibt ja auch noch einen ideellen Gewinn aus dem Studium," sagt Dikigoros. "Sie meinen, die Frau hat hinterher höhere Ansprüche, oder wie drückt sich das sonst aus?" - "Ja, aber die müssen ja nicht immer nur materieller Natur sein. Ich wollte nicht mit einer Analfabetin verheiratet sein." - "Das ist doch nicht Ihr Ernst, oder? Lernt man lesen, schreiben und rechnen bei Ihnen erst auf der Universität? Bei uns tut man das auf der Volksschule. Was hat Ihre Frau auf der Universität gelernt, worüber Sie sonst nicht mit ihr sprechen könnten? Wir haben hier auch so einen Fall; fragen Sie mal unseren Tourist Officer - der ist todunglücklich in seiner Ehe." Dikigoros schweigt verdattert. "Lassen Sie mich anders herum anfangen," sagt der Ladenhüter, "Sie meinen also, eine Familie sollte sich nicht auf Jahrzehnte hinaus verschulden, um ihre Töchter zu verheiraten." - "Na, zumindest nicht auch die Brüder - wie kommen die dazu?" - "Die Söhne erben, die Töchter nicht, außer dem Silberschmuck der Mutter; die Aussteuer ist also gewissermaßen der vorab ausgezahlte Erbteil. Hat Ihr Schwiegervater ein Haus?" - "Ja." - "Und wer wird das erben?" - "Meine Frau und ihre Schwester zu gleichen Teilen." - "Und wenn sie einen Bruder hätte?" - "Genauso." - "Sehen Sie, in Indien bekämen es nur die Brüder oder die nächsten männlichen Verwandten. Hat Ihr Schwiegervater das Geld für das Haus bar auf den Tisch gelegt, oder wie lange hat er gebraucht, um es abzuzahlen?" - "Äh..." [Dikigoros weiß es nicht, denn er hat seinen Schwiegervater nie danach gefragt, und der hat es ihm auch nie von sich aus erzählt - aber das würde ihm sein Gesprächspartner schwerlich glauben.] - "Sind Sie sicher, daß das weniger lange war als wir Inder durchschnittlich die Aussteuer unserer Töchter abzahlen, die zugleich als Alterssicherung dient, wie bei Ihnen das Haus? Und wenn Sie von hoffnungsloser Verschuldung reden: Wie viele Häuser landen bei Ihnen unter dem Hammer, weil die Besitzer ihre Hypotheken nicht mehr bedienen können? Und ist dann nicht alles weg, das Haus, das Geld und damit auch die Altersvorsorge? Wenn bei uns der Brautvater zahlungsunfähig wird, dann sind die Töchter dennoch versorgt, denn sie haften nicht für die Schulden ihrer Väter."
"Bei uns im Westen besteht die Altersvorsorge nicht allein aus dem Haus; wir haben im Gegensatz zu Ihnen ein ziemlich dichtes Netz von Sozialversicherungen; bei uns verhungert niemand, weil er alt ist oder krank oder arbeitslos." - "Bei uns auch nicht, vorausgesetzt, er hat Kinder, die er gut erzogen und versorgt hat, dann werden die später selbstverständlich für Ihre bedürftigen Eltern und Großeltern sorgen, ebenso wie für die anderen Verwandten. Ich glaube, daß das ein sehr gutes Sozialversicherungssystem ist - glauben Sie, daß Ihres im Westen besser ist? Worauf beruht das eigentlich? Ich habe das nie so genau kapiert. Wer zahlt da was für wen, und wer bekommt wann was heraus?" - "Jeder zahlt als Beitrag einen bestimmten Prozentsatz seines Einkommens in eine staatliche Kasse ein, die das Geld verwaltet, und im Alter bekommt er dann eine Rente entsprechend dem, was er eingezahlt hat." - "Aber wofür braucht man denn da eine staatliche Kasse? Ist das nicht ein gewaltiger Verwaltungs- und Kostenaufwand? Wäre es nicht klüger, jeder würde selber auf sein Alter sparen?" - "Na, Sie sind vielleicht lustig. Erstens kann doch nicht jeder seiner Frau einen Zentner Silbermünzen um den Hals hängen, und zweitens, überlegen Sie mal: In Europa hat es im 20. Jahrhundert zwei Weltkriege gegeben, mit Inflation und Währungsreform, danach war alles Geld auf der Bank praktisch wertlos." - "Und die Häuser in den zerbombten Städten? Vielleicht hätten Sie die Ersparnisse doch in Silber anlegen sollen?" - "Ach was, das hätte gar nichts geholfen; die Briten und ihre Verbündeten haben ja nach dem Krieg alles geraubt, was nicht niet- und nagelfest war, besonders Nazi-Orden und Silbermünzen mit Hakenkreuz drauf." - "Ja, und nun?" - "Nun ist eben die Solidargemeinschaft eingesprungen; die Rentner bekommen Geld, obwohl ihre Ersparnisse eigentlich verloren waren - sonst hätten sie verhungern müssen." - "Heißt das, das Geld, das Sie jetzt einzahlen, bekommen Sie später gar nicht zurück, sondern damit werden andere ausbezahlt, deren Beiträge jetzt wertlos sind?" - "Ja, meine Eltern-Generation zum Beispiel, die haben ja auch lange genug hart gearbeitet für den Wiederaufbau. Das nennt man Generationen-Vertrag."
"Gut, aber setzt das nicht voraus, daß immer genügend Kinder vorhanden sind? Ich habe mir sagen lassen, daß im Westen immer mehr Leute immer weniger Kinder haben." - "Und ich habe mir sagen lassen, daß in Indien Eltern vor der Geburt das Geschlecht ihrer Kinder feststellen lassen, und wenn es ein Mädchen ist, das nur Mitgift kosten würde, lassen sie es abtreiben." - "Wer hat Ihnen das gesagt?" - "Es steht in den Zeitungen. Wollen Sie es bestreiten?" - "Ja, ganz entschieden, ich habe drei Söhne und vier Töchter, und ich habe keine abtreiben lassen. Ich habe also mehr als genug getan für meine Alterssicherung." - "Nun, Sie haben das vielleicht nicht getan, aber würden Sie es auch für andere ausschließen?" - "Ja, für alle, die halbwegs klar denken können. Nehmen Sie doch mal an, alle Inder würden künftig ihre Töchter abtreiben - dann wären die Söhne doch auch nichts mehr wert, denn wer soll ihnen eine Mitgift zahlen, wenn es keine potentiellen Schwiegertöchter und somit auch keine Enkel mehr gibt? Und sehen Sie, es bleibt ja oft in der Familie. Das mit der Exogamie, von der Sie vielleicht gelesen haben, wird nur in den Dörfern auf dem Lande so eng gesehen - aber da wird auch kaum abgetrieben. In den Städtchen wird dann halt schon mal der Vetter mit der Cousine verheiratet, damit das Geld in der Familie bleibt, wenn es sonst nicht reicht. Aber das soll doch bei Ihnen im Westen früher ganz ähnlich gewesen sein." - "Aber nicht das mit den Mädchen-Abtreibungen." - "Nein, das soll sich bei Ihnen auch auf die Jungen erstrecken. Wie ich gehört habe, werden bei Ihnen rund ein Drittel der Schwangerschaften abgebrochen, und das trotz Verhütung. Es grenzt ja an ein Wunder, daß bei Ihnen überhaupt noch Kinder geboren werden." - "Das ist von Staat zu Staat verschieden; die streng katholischen Länder, in denen Abtreibung bisher ganz verboten war, haben jetzt halt einen besonders großen Nachholbedarf." - "Ach, einen Nachholbedarf haben die? Warum bringen sie dann nicht noch rückwirkend die Kinder um, die sie vor zehn oder zwanzig Jahren nicht abtreiben durften, wenn ihnen das so leid tut? Wie ist das in Ihrem Land?" - "Ja, wissen Sie, die Bevölkerungsdichte ist halt bei uns etwas höher als hier in Khajurāho." - "Hier in Khajurāho wird nicht abgetrieben; mir ist jedenfalls kein einziger Fall bekannt. Und in den Städten, wo bei uns abgetrieben wird ist die Bevölkerungsdichte, glaube ich, erheblich höher als in irgendeiner Stadt der westlichen Welt. Und die Armut auch. Bei Ihnen wird doch schon abgetrieben, wenn die Familie in ein größeres Haus umziehen oder ein größeres Auto kaufen müßte." - "Und was tun Sie in so einem Fall?" - "Wir rücken halt zusammen und leben ein wenig beengter - im Haus wie im Auto." - "Aber da liegt doch der Hase im Pfeffer. Kinder bedeuten eben nicht mehr Reichtum und nicht mehr Alterssicherung, sondern nur Aufteilung der Ressourcen unter mehrere, so daß am Ende für jeden einzelnen weniger übrig bleibt. Wenn Ihre vielen Kinder sich keine ordentliche Berufsausbildung leisten können und keinen Job finden, in dem sie ordentlich Geld verdienen können - wie sollen die Sie dann im Alter unterstützen?" - "Das ist doch keine Frage der Kinderzahl oder der Ausbildung. Wie ich gehört habe, finden auch bei Ihnen immer mehr junge Leute keinen Job, obwohl sie Jahre lang zur Schule oder zur Universität gegangen sind." - "Na ja." [Das war, bevor der große Zusammenbruch des deutschen Arbeitsmarktes unter der rot-grünen Regierung Schröder einsetzte, Anm. Dikigoros.] - "Man kann seine Eltern im Alter auch auf andere Weise unterstützen, wenn man nicht soviel Geld übrig hat. Wie ich gehört habe, besteht die Unterstützung bei Ihnen vielfach darin, daß man die alten Menschen in ein teures Altersheim abschiebt und sich dann nicht mehr persönlich um sie kümmert - finden Sie das besser?" - "Jedenfalls haben die Menschen dort ein würdiges Leben, anders als manche alte Leute, die ich hier mehr oder weniger auf der Straße haben verrecken sehen." [Damals kannte Dikigoros die Zustände in deutschen Alters- und Pflegeheimen noch nicht, soviel sei zu seiner Entschuldigung gesagt. Er war halt noch ziemlich blauäugig, wie ja auch der Rest der Diskussion zeigt.] - "Hier in Khajurāho?" - "Nein, aber anderswo." - "Sterben im Westen keine Menschen auf der Straße?" - "In meinem Land nicht." - "Bei uns auch nicht - jedenfalls dann nicht, wenn sie genügend Nachkommen bekommen und richtig erzogen haben." - "Jetzt sind Sie wieder am Ausgangspunkt unserer Diskussion angelangt; damit ist noch nicht bewiesen, daß unser Sozialversicherungs-System grundsätzlich schlechter ist als Ihres."
"Was heißt schon 'grundsätzlich'? Auf dem Papier? In der Theorie? Es kommt doch auf die praktischen Bedürfnisse an; und Ihr Sozialversicherungs-System steht offenbar nicht im Einklang mit Ihrer Bevölkerungs-Entwicklung. Wie lange kann Ihre Rentenkasse das wohl noch verkraften, wenn es so weiter läuft wie bisher?" - "Vielleicht nicht mehr lange; aber dann muß es halt den praktischen Bedürfnissen, wie Sie das nennen, angepaßt werden, d.h. es müssen entweder die Beiträge erhöht oder die Renten gekürzt werden." - "Ja, aber das kann die Pleite doch nicht verhindern, sondern nur hinaus zögern. Wie lange besteht Ihr System schon?" - "In Deutschland etwas länger als hundert Jahre." - "Das indische Sozialsystem besteht und funktioniert seit Jahrtausenden; ich glaube nicht, daß es schlechter ist." - "Was nennen Sie Sozialsystem?" - "Das System der Familien. Finden Sie es nicht ungerecht, daß jemand, der keine Kinder hat, sich ein schönes Leben macht und später von den Beiträgen, die Kinder anderer Leute einzahlen, Rente bekommt? Und daß derjenige, der unter großen materiellen Opfern Kinder aufzieht, dessen Frau deshalb vielleicht nicht mitarbeitet, der also nur halb soviel einzahlt, später nur halb soviel Rente bekommt wie der andere? Obwohl es seine Kinder sind, die sie erwirtschaften? Bei uns geht es im Alter nur denjenigen gut, die Kinder groß gezogen haben, die sie unterstützen können; mir scheint, bei Ihnen ist es genau umgekehrt?!" - "So dürfen Sie das nicht sehen," sagt Dikigoros, "Sie müssen das Gesamtsystem berücksichtigen." - "Inwiefern?" - "Schauen Sie, wenn in einer Familie nur einer arbeitet, dann zahlt er z.B. nur einmal Krankenversicherungs-Beitrag, und dafür ist seine ganze Familie, einschließlich nicht berufstätiger Frau und aller Kinder versichert, und zwar genauso gut wie ein Ehepaar ohne Kinder mit doppeltem Einkommen, das zweimal voll bezahlen muß." - "Wieso zweimal voll? Wonach richtet sich denn der Krankenversicherungs-Beitrag?" - "Natürlich auch nach dem Einkommen." - "Was ist denn daran natürlich? Ich finde das eher unnatürlich. Richtig müßte es doch so sein, daß derjenige, der gesund lebt und weniger Ärzte und Apotheker braucht, weniger zahlt, und derjenige, der ständig krank ist, mehr." - "Aber das wäre doch unsozial." - "Wieso? Wer praßt und schlemmt, eine Säuferleber, ein Raucherbein und ein verfettetes Herz hat, bekommt seine Behandlung von denjenigen bezahlt, die ein vernünftiges, anspruchsloses Leben führen, sich gesund ernähren..." - "Wenn das immer so einfach wäre. Es gibt auch unverschuldete Krankheiten." - "Ach was. Wer täglich Dāl ißt und Wasser trinkt wird nicht krank." - "Das ist aber nun nicht jedermanns Sache." - "Muß es ja auch nicht. Aber für seine selbst verschuldeten Krankheiten sollte schon jeder alleine aufkommen, oder halt seine Familie, die ja mit schuld ist, wenn sie jemanden so ungesund leben läßt."
"Ich habe nicht den Eindruck, daß die Krankheiten in Indien vornehmlich durch Freß- oder Genußmittelsucht hervor gerufen werden," sagt Dikigoros, "eher im Gegenteil. Was soll denn ein armer Bettler mit Hungerödemen machen?" - "Den behandelt der Arzt doch umsonst - wo ist das Problem?" - "Wieso behandelt der Arzt den umsonst?" - "Ja was, wollen Sie mir erzählen, daß bei Ihnen die Ärzte und Apotheker von allen Leuten gleich viel nehmen, egal wie arm oder reich sie sind?" - "Ja." - "Das glaube ich Ihnen nicht. Ich habe gehört, daß es in europäischen Krankenhäusern Klassen gibt, eine für reiche, eine für mittlere und eine für arme Leute. Stimmt das nicht?" - "Doch, das stimmt, aber die ersten beiden Klassen sind für Leute, die sich zusätzlich noch privat versichern." - "Was heißt das, zusätzlich?" - "Na ja, ein Beamter bekommt z.B. die Hälfte seiner Arzt- und Apotheker-Kosten vom Arbeitgeber ersetzt, und für den Rest kann er sich privat versichern, dann bekommt er ein Krankenbett 2. Klasse. Und ein Selbständiger muß sich ganz privat versichern, der bekommt dann 1. Klasse. Aber dafür bezahlt er auch sehr viel mehr als der normale Versicherungsnehmer. Übrigens sind unsere Krankenhäuser 3. Klasse im Durchschnitt wesentlich besser ausgestattet als die besten indischen." - "Glauben Sie wirklich, daß krank und wieder gesund werden von der Ausstattung eines Krankenhauses abhängen?" - "Nicht nur, aber auch." - "Ich glaube, daß es viel mehr auf die persönliche Pflege ankommt. Wieviel Zeit widmet Ihnen Ihr Arzt im Durchschnitt bei einem Besuch?" - "Ich war schon lange nicht mehr krank," redet sich Dikigoros heraus, "das kann ich mir als Selbständiger zeitlich nicht leisten." - "Sie sagen, die Beiträge für private Kranken-Versicherungen seien so teuer. Was kosten sie denn für 3. Klasse?" - "Das ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Im Schnitt so um die 15% vom Brutto-Monatseinkommen." - "Das ist ja Wahnsinn. Und die Renten-Versicherung?" - "Knapp 20% vom Brutto-Monatseinkommen. Und dann kommt noch die Arbeitslosen-Versicherung..." - "Nein, wer soll denn das alles bezahlen?" - "Der Arbeitgeber zahlt die Hälfte dazu." - "Freiwillig?" - "Nein, er ist gesetzlich dazu verpflichtet." - "Hm, ich habe gehört, daß in Europa jetzt immer mehr Menschen arbeitslos werden." - "Nicht mehr als es in Indien schon sind." - "In Indien ist niemand arbeitslos. Hier arbeiten alle sehr hart um das tägliche Überleben, auch wenn sie es nicht immer in klingender Münze bezahlt bekommen; aber es kann halt nicht jeder in einem festen Anstellungs-Verhältnis sein. Muß der Arbeitgeber auch zur Arbeitslosen-Versicherung die Hälfte dazu zahlen?" - "Ja, und die Unfallversicherung sogar ganz." - "Lassen Sie mich mal nachrechnen, da geht ja fast die Hälfte des Lohns für dieses famose Sozialversicherungs-System drauf, oder?" - "Schon möglich." - "Kann es vielleicht sein, daß Sie so viele Arbeitslose haben, weil die Arbeitgeber diese Kosten nicht mehr aufbringen wollen oder können?" - "Hm... zum Teil vielleicht, schon möglich." - "Wäre es da nicht klüger, Sie würden die Arbeitslosen-Versicherung abschaffen und dafür mehr Arbeitsplätze schaffen? Ich meine, das wäre doch sinnvoller, als den arbeitenden Menschen Geld dafür abzunehmen, die nicht arbeitenden Menschen damit zu bezahlen, oder?"
"Tja, das ist alles nicht so einfach," sagt Dikigoros, "irgendwoher müssen die Sozialtöpfe doch gespeist werden." - "In dieser Höhe?" - "Ja, Qualität hat eben ihren Preis, und das Solidaritäts-Prinzip..." - "Ich höre immer Solidaritäts-Prinzip. Ihre Ärzte, verdienen die relativ gut oder schlecht?" - "Theoretisch gut, aber es gibt große Unerschiede. Manche sind Millionäre, andere haben Millionen Schulden." - "Woran liegt das?" - "Nun, in der Stadt gibt es halb mehr Kranke als auf dem Land, und in manchen Gegenden ist die Ärztedichte höher oder niedriger." - "Ach so, ja, für die Arbeit an sich bekommen die Ärzte ja immer das gleiche, egal von welchem Patienten." - "Bis auf die privat versicherten, da bekommen sie etwas mehr, aber auch nicht mehr viel." - "Wieviel?" - "15%." - "Wissen Sie was? Das Finanzierungs-Problem Ihres Sozialversicherungs-Systems bekommen Sie nicht auf der Einnahmeseite geregelt, indem sie ständig die Beiträge erhöhen. Sie müssen auf der Ausgabenseite sparen. Es ist doch unsozial, daß ein Arzt für die Behandlung eines Armen ebensoviel Geld nimmt wie für die eines Reichen." - "Sonst würde er die Armen vielleicht gar nicht mehr behandeln, sondern nur noch die Reichen." - "Das glaube ich nicht, und ich glaube auch nicht, daß Ärzte Millionäre sein müssen. Was sind das für Typen, die sich am Unglück ihrer Mitmenschen reich verdienen?" - "Wir haben ein anderes Rechtsempfinden. Wir finden es nicht richtig, wenn Sie einem armen Kunden für dieselbe Ware weniger Geld abnehmen als einem reichen Kunden. Das Produkt ist doch das gleiche, oder?" - "Wieso, welches Produkt?" - "Na, Ihre Seide, Ihr Nippes, Ihre Münzen, das hat doch einen bestimmten Wert, der unabhängig vom Käufer ist, oder?" - "Nein, wieso denn? Jedes Produkt, wie Sie das nennen, ist das Ergebnis einer Arbeit oder einer Dienstleistung. Wenn Sie auf dem Markt eine Kokosnuß kaufen zahlen Sie doch nicht den Wert der Nuß, sondern den Wert der Dienstleistung: Wollen Sie selber auf die Palme klettern und die pflücken?" - "Natürlich nicht." - "Sehen Sie, und ist die Zeit, die Sie die dabei einsparen, und das eingesparte Risiko, vom Baum zu fallen oder sich beim Aufschlagen mit dem Messer am Daumen zu verletzen, nicht mehr wert als die eines Bettlers?" - "Hm..." - "Was machen Sie beruflich?" - "Anwalt." - "Und wenn zu Ihnen ein Armer kommt?" - "Äh... was verstehen Sie unter einem Armen?" - "Nun, bei uns bekommt so jemand Armenrecht." - "Ach ja, richtig, bei uns auch, 50% Rabatt aufs Anwaltshonorar." - "Eben. Warum geht das bei den Ärzten und Apothekern nicht auch? Oder würden die dann verhungern? Sind Sie schon an einem Armenrechtsfall verhungert?" - "Ja, äh... solche Fälle gebe ich an Kollegen weiter, die nicht so gut im Geschäft sind, aus Gründen des Solidaritäts-Prinzips," stottert Dikigoros und versucht, nicht rot zu werden. "Wenn Sie es aus Solidarität tun, warum geben Sie Ihren Kollegen dann nicht einen Ihrer lukrativen Fälle ab und machen selber den Armenrechtsfall?" - "Die Mandanten mit den lukrativen Fällen legen halt großen Wert auf persönliche Betreuung, die kann ich nicht einfach an irgendeinen Feld- Wald- und Wiesen-Advokaten weiter reichen." - "Aber den Armen können Sie weiter reichen?"
Dikigoros sagt erstmal nichts mehr; für den Tag hat er genug, um nachzudenken. Vielleicht hätte er dem Händler sagen sollen, daß in Indien viele Mädchen nicht mal lesen, schreiben und rechnen können, weil sie nicht mal auf die Volksschule gegangen sind - aber dann hätte der ihm womöglich erzählt, daß er, der Vater, ihnen das viel besser beibringen kann als so ein dummer Lehrer, und ihn gefragt, wer ihm das denn beigebracht habe (und hätte er lügen sollen)? Oder daß es sehr wohl genügend Arbeitsplätze für gut ausgebildete Frauen gäbe in Deutschland, und lediglich überzogene "Schutz"-Gesetze verhindern, daß sie auch eingestellt werden - wenn er dem Händler erzählt hätte, daß Arbeitgeber ihren weiblichen Arbeitnehmer auch dann den vollen Lohn fortzahlen müssen, wenn sie schwanger, wenn sie oder ihre Kinder krank sind, dann hätte der womöglich zurück gefragt, ob dafür nicht der Ehemann und Vater aufkommen müßte. Ganz zu schweigen von Nachtschicht-Zulagen, die den Frauen gezahlt werden müssen, obwohl sie gar nicht nachts arbeiten dürfen, um sie mit den Männern, die Nachtschicht arbeiten, "gleich" zu stellen. Oder von den Arbeitsplätzen, die im Schwangerschaftsurlaub Jahre lang frei gehalten werden müssen. Oder von gleichem Lohn für gleiche Arbeitszeit statt für gleiche Arbeitsleistung. (Die indische Frau bekommt im Steinbruch das gleiche Gehalt wie der indische Mann - aber sie arbeitet wie er im Akkord, und da sie nun mal in der gleichen Zeit nur halb so viele Steinchen klopft wie er, bekommt sie nur die Hälfte heraus - welcher Arbeitgeber wäre da wohl so blöde, eine Frau zum gleichen Stundenlohn einzustellen wie einen Mann?) Oder von Dutzenden anderen Arbeitsverhinderungs-Maßnahmen... Als Frau Dikigoros das liest, meint sie nur ungehalten: "Der Arbeitgeber wäre auch blöde, den Mann zum Stundenlohn anzustellen statt im Akkord; denn Männer mögen zwar theoretisch in der Lage sein, mehr zu arbeiten als Frauen, aber in der Praxis sieht das meist ganz anders aus. Das sehe ich doch jeden Tag im Büro: In der Zeit, in der ein Mann eine Akte bearbeitet, bearbeitet eine Frau mindestens zwei; und dabei kommt es ja auch nicht auf die Körperkraft an. Ein Chef, der Männer statt Frauen einstellt, bloß weil die pro Stunde mehr Steinchen klopfen könnten als eine Frau, muß also selber ganz schön bekloppt sein. Und was die kranken Kinder anbelangt, so wäre ich auch dafür, daß sich nicht immer nur die Mütter, sondern auch die Väter mal etwas mehr um die kümmerten." - "So etwas können Frauen halt besser." - "Ach, und warum verdienen dann Krankenpfleger mehr als Krankenpflegerinnen? Vielleicht weil sie theoretisch mehr Nachpötte pro Stunde schleppen können?" Dikigoros fällt dazu auf Anhieb keine Antwort ein - aber es tut ja eigentlich auch gar nichts zur Sache.
Am letzten Tag in Khajurāho besucht er den Tourist Officer, um zu erfahren, weshalb der so unglücklich sein sollte. (Vom Restaurant-Inhaber weiß er es inzwischen - einer der vielen Jünglinge, die ständig um seinen Tisch herum scharwenzeln, um ihm irgend etwas aufzuschwatzen, hat es ihm erzählt: Die Italienerin war keine Jungfrau mehr, aber das hat er erst in der Hochzeitsnacht gemerkt, und da wollte er sich die Blamage nicht mehr antun, sie fort zu jagen.) "Wie gefällt es Ihnen hier?" fragt ihn der T.O. "Sehr gut. Und Ihnen?" Der T.O. macht ein belämmertes Gesicht. "Na hören Sie mal, Sie haben doch einen schönen Lenz hier, an einem der attraktivsten Touristenorte überhaupt in Indien; und überarbeiten tun Sie sich auch nicht: den ganzen Tag Däumchen drehen oder sich mal nett mit dem einzigen Touristen unterhalten, den es gibt." - "Vorhin war noch eine Gruppe da, mit dem Bus. Eine halbe Stunde Besichtigung der westlichen Tempel, d.h. einmal durch gelaufen, eine halbe Stunde für einen Tee im Café mit Pinkelpause, dann sind sie wieder weg; mir haben sie nicht mal guten Tag gesagt. Ich glaube, es waren Schweizer." - "Aber das ist doch kein Grund zur Traurigkeit, oder?" - "Ich bin so weit weg von meiner Familie." - "Na, Sie sind doch ein erwachsener Mann, der nicht jeden Tag zur Mutti..." - "Ich meine meine eigene Familie; meine Frau ist Lehrerin und arbeitet 150 Meilen weit weg; wir sehen uns nur ganz selten, denn ich habe ja auch am Wochenende Dienst." - "Warum läßt sich Ihre Frau nicht hierher versetzen?" - "Hier gibt es keine höhere Schule." - "Sind Sie denn so dringend auf ihr Einkommen angewiesen?" - "Oh ja, ein Tourist Officer verdient schlecht; es sei denn, er bekäme reichlich Trinkgelder; aber wenn keine Touristen kommen... und Leute wie Sie finden ja alles selber; Sie sind schon überall das Tagesgespräch: Sie kaufen nichts, sie mieten nichts, nichtmal ein Rikshā zum Hotal, obwohl Sie das am äußersten Ortsrand genommen haben..." - "Sie hatten es mir empfohlen - übrigens eine sehr gute Empfehlung, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und die paar 100 Meter gehe ich querfeldein schneller zu Fuß als das Rikshā über die Straße fährt." - "Sie essen nur zweimal am Tag Nudeln beim Italiener und trinken von morgens bis abends Tee, obwohl es hier alles gibt, sogar Alkohol und Frauen - wie soll ein Touristenort von Leuten leben, die in fünf Tagen zusammen nichtmal tausend Rupyen ausgeben?"
Nachtrag. Tja, diese Frage stellen sich viele für Fremdenverkehr verantwortliche Politiker, nicht nur in Indien. 1.000 Rupyen, das waren damals 24 US-$. Aber wofür soll ein Tourist Geld ausgeben? Wem es um Alkohol und/oder Prostituierte geht, der macht woanders Urlaub; ein gutes Hotel kostet 100 Rp. pro Nacht, ein Essen beim Italiener 30 Rp., eine Kanne Tee mit Milch und Zucker 5 Rp. und der Eintritt für alle Ruinen und Museen am Ort zusammen 1 Rp. pro Tag. Aber würde das umgekehrte Extrem die Touristen nicht erst recht abschrecken? Ein indischer Teilstaat, Bhūtān, hat es neuerdings versucht, indem er - nach dem Vorbild der untergegangenen CoMeCom-Staaten - den Zwangsumtausch eingeführt hat. Erinnert Ihr Euch noch, liebe Wessis, wie Ihr damals über die böse DDR geflucht habt? Dabei waren das vergleichsweise Peanuts, die man Euch da abnahm, und man konnte die Aluchips trotz alledem noch irgendwie los werden, und sei es, daß man jeden Tag zweimal gut essen ging. Aber im "Land des Drachens" beträgt der Zwangsumtausch 240 US-$ pro Tag - und die kann man beim besten Willen nicht sinnvoll ausgeben in einem Land, wo das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen 100 US-$ pro Jahr beträgt! Eine Portion des Nationalgerichts "Ema Datshī" - eine Art Risotto - kostet selbst im teuersten Restaurant umgerechnet nicht mehr als 1 US-$, d.h. selbst wenn man das rund um die Uhr futtern wollte... Und deswegen braucht man nicht hinzufahren, zumal in den letzten Jahren die Reisernte so erbärmlich ausgefallen ist, daß die Drachenländer nicht mehr genug von dem unter Kennern begehrten roten Reis (den Ihr in Deutschland unter der Bezeichnung "Red Cargo" in Asia-shops findet, meist aus Thailand; für 240 US-$ bekommt Ihr als Endverbraucher ca. 2 Zentner :-) haben und minderwertiges Zeug importieren müssen, um die Bevölkerung irgendwie zu ernähren. Der Staatshaushalt wird zu 60% von Indien finanziert, zu 30% aus Entwicklungshilfe (vor allem aus der BRDDR, der RÖ und der Schweiz), zu 4% aus eigenen Mitteln (davon knapp die Hälfte aus dem Verkauf von Strom aus Wasserkraftwerken nach Bangla Desh), und der Rest ist Defizit, das vor sich her geschoben wird; und die Staatsverschuldung wächst von Jahr zu Jahr weiter... Ach so - und der Anteil des Tourismus? Dreimal dürft Ihr raten, liebe Leser - und laßt Euch nicht von den getürkten Statistiken blenden: Pro Jahr kommen rund 20.000 "Touristentage" zusammen (offiziell als ebenso viele Touristen gerechnet, weil von der Fiktion ausgegangen wird, daß sie jeweils nur einen Tag bleiben :-), d.h. Bhūtān nimmt knapp 5 Mio US-$ aus Zwangsumtausch ein, das deckt nicht mal 1% des Staatshaushalts - ob es nicht klüger wäre, die Touristen weniger zu schröpfen und dafür ein paar mehr ins Land zu lassen, die dann freiwillig mehr ausgäben? Aber der T.O. würde diese Frage, wenn Dikigoros sie ihm stellte, wohl mit dem Satz beantworten: "Wenn die alle so geizig wären wie Sie, brächte das bestimmt keinen Vorteil!" Nachtrag Ende.
Szenenwechsel. Dikigoros ist in Bundelkhand, in einem alten, mehr oder weniger verfallenen Schloß abgestiegen - wenn Ihr so wollt in der "Hauptstadt" des Duodez-Fürstentums, das eigentlich nie eines war, denn die stolzen Bundelīs - die allesamt zur Kriegerkaste gehören - hätten nie einen Fürsten über sich anerkannt. Noch vor nicht allzu langer Zeit war es ein verwunschenes Schloß wie das von Dornröschen, hinter dem sich weite Schafweiden erstreckten, inmitten deren die Ruinen eines noch älteren Schlosses lagen. Öffentlichen Verkehrsverbindungen - Fehlanzeige; man muß bis zur nächsten größeren Stadt mit dem Bus fahren und von dort einen "Skūtar" [Motorroller-Taxi, von englisch scooter] nehmen, einstmals über Stock und Stein; aber dann wurde erst eine einspurige Straße gebaut (die zweite Spur ist, als Dikigoros ankommt, gerade im Bau - mindestens die Hälfte der Bauarbeiter sind übrigens Frauen), und nun können auch Privatautos hin fahren, und der Ort ist zum "Geheimtip" geworden. Zum Glück erstmal nur für besser betuchte Inder, denn für Billigreisende ist es denn doch zu teuer, und für Ausländer mit gehobenen Ansprüchen nicht fein genug. (Die beiden einzigen Räume, die offiziell vermietet werden - als "Suiten" - sind auf Wochen hinaus ausgebucht, und zwar nicht nur reserviert, sondern auch belegt, sonst würde Dikigoros nicht lange fackeln; aber während andere Reisende abgewiesen werden, erreicht er mit seiner geduldigen Hartnäckigkeit, daß man ihm ein Zimmerchen im Nebentrakt außer der Reihe zur Verfügung stellt - er stellt ja keine hohen Anforderungen an Komfort.) Vor allem das Essen läßt an Quantität und Qualität ziemlich zu wünschen übrig - vom eleganten Speisesaal mit den viel zu kleinen Tischen und Stühlen kann man nicht abbeißen, und die Speisekarte wirkt zwar ziemlich imposant, besagt aber nichts darüber, was die Küche tatsächlich hergibt. Doch weiter unten am Fluß ist gerade ein großer, moderner Klotz fertig geworden (für westliche Verhältnisse noch einigermaßen geschmackvoll, da nur anderthalb Stockwerke hoch), ein Hotel besserer Ausstattung mit ebensolchem Restaurant, das sicher bald auch ausländische Touristen anziehen wird, und dann wird Schluß sein mit der Idylle. Und mit den Preisen - einige sind ja jetzt schon zu hoch, z.B. die Eintrittsgebühr für die Waffen- und Gemäldegalerie des Hotel-Schlosses, die so berühmt ist, daß zu ihrer Besichtigung ganze Familien aus dem fernen Delhi anreisen. Dikigoros wartet ab und trinkt Tee, während er den Horden zuschaut, die sich hinein und wieder heraus drängen lassen wie eine Hammelherde. Als sie fort sind, fragt ihn der Kastellan, ob er sich das nicht auch mal ansehen wolle. "Ich dachte, die Öffnungszeiten sind schon vorbei?!" - "Privatführung von mir, nur 5 Rp." [Das sind damals 25 Pf oder - für jüngere Leser - 13 Teuro-Cent.] Es ist nichts Weltbewegendes, Dikigoros hat - zumal in Indien - schon bessere Schloß-Museen gesehen (nein, nicht da, wo die meisten Touristen hin gekarrt werden, in Udaypur oder Maisur, da war er zwar auch schon - aber ein paar Geheimtips müssen ja noch geheim bleiben :-) und kann sich ein Grinsen nicht verkneifen, als er in der Vitrine am Ausgang die dicken Bildbände liegen sieht, à 25 US-$ (das ist der Wochenlohn eines indischen Beamten im gehobenen Dienst). "Habt Ihr davon schon mal was verkauft?" - "Gewiß." Der Kastellan schließt die Vitrine auf, holt die Bücher heraus, zeigt Dikigoros die Bilder und erläutert ihre Bedeutung - alles im Preis der Führung drin.
Aber dafür fährt man ja nicht hierher, sondern wegen der Ruinenfelder weiter draußen. Auch darauf ist das Schloßhotel eingerichtet: Man kann, halb- oder ganztägig, einen Führer mieten (zu ziemlich happigen Preisen) oder eine Kassette mit Recorder und Kopfhörer (etwas billiger, jedenfalls wenn man sie heil zurück bringt, denn der Pfandbetrag ist teurer als die Leihgebühr), in allen möglichen Sprachen (sogar Italienisch, nicht aber Deutsch). Oder man latscht einfach auf gut Glück alleine los. "Tun Sie's nicht, Sahib," meint der Empfangschef, "Sie würden sich bloß verlaufen." Da hat er im Prinzip sicher Recht, aber Dikigoros ist ja nun ein alter, erfahrener Indien-Reisender, der schon mal so drauflos ziehen kann. Nach einiger Zeit trifft er - oder treffen ihn - zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen im Grundschulalter, die ihn ansprechen, mit den üblichen englischen Brocken, die in Indien jedes Kind schon im Vorschulalter aufschnappt: "Wäyufromm [where are your from = woher kommst du]" und "Wäyugoh [where do you go = wohin gehst du]". (Dikigoros setzt bewußt keine Fragezeichen, denn im Indischen lassen sich Fragen nicht an der Intonation erkennen, sondern an der Nachsilbe "kyā" - eine Idee, die übrigens Zamenhof für seine Kunstsprache Esperanto übernommen hat.) Die Kinder sprechen als Muttersprache Bundelī - das ist von Kharī Bolī [Hoch-Hindī] nicht allzu weit entfernt, etwa wie amerikanisches von britischem Englisch, Dikigoros kann sich gut mit ihnen verständigen, und sie kennen die alten Ruinenfelder wie ihre Westentasche - es ist ihr gewöhnlicher Spielplatz. Er alleine hätte sich wahrscheinlich gar nicht die alten, engen Wehrtürme hinauf getraut (wenn er denn überhaupt die Eingänge gefunden hätte), und wenn er einmal oben gewesen wäre, hoffnungslos verlaufen.
Auf den Zinnen (wie auch auf denen des Schloßhotels) sitzen, nein hocken [irgendwem müssen die Inder doch ihre bevorzugte Ruheposition abgeschaut haben!] Geier - große, imposante Vögel, wenn man sie aus der Nähe sieht - und warten schon auf unvorsichtige Touristen... Normalerweise würde Dikigoros Kindern für ihre Führerdienste allenfalls ein paar Aluchips geben (die 1-, 2-, 5- und 10-Paise-Stücke sind aus Aluminium, wie die alte DDR-Währung), denn die Ehre, mit einem hellhäutigen Ausländer ein paar Stunden zusammen zu sein, muß für sie Lohn genug sein, zumal auf dem Land, wo man kaum je einen zu Gesicht bekommt; und wenn sie so unverschämt sind wie diese beiden hier und pro Kopf 5 Rupyen verlangen (was immerhin der Stundenlohn des alten, erfahrenen Kastellans war!) bekämen sie gar nichts; aber in diesem Fall macht er eine Ausnahme und gibt ihnen zusammen einen 5-Rupyen-Schein - und zwar dem Mädchen, damit sich der Junge nicht damit aus dem Staub macht. Auf dem Rückweg - es geht schon gegen Abend zu - sieht er am Straßenrand die Elterngeneration hocken, die ihm irgendwelchen Nippes andrehen will: Schlecht gelaunte Gesichter, die offenbar den ganzen Tag keine Paisā Umsatz gemacht haben - was müssen die denken, wenn ihre Kinder abends mit einem Geldschein ankommen? Bestimmt nicht, daß es klug wäre, sie am nächsten Tag zur Schule zu schicken... Aber es ist müßig, sich darob Gewissensbisse zu machen; wenn in den nächsten Jahren erst die Touristenströme zu fließen beginnen, werden kleine Kinder, die nur Bundelī sprechen, ohnehin bald vom Fremdenführer-Markt verdrängt sein; und immer noch besser, die Kinder verdienen ihr Geld auf dem Ruinenfeld als im Puff.
Exkurs, vor dessen Lektüre Ihr, liebe Leser, Euch bitte nicht drücken wollt, denn das Thema geht jeden an, der sich für Reisen in die Dritte Welt interessiert: Kinder-Arbeit im allgemeinen und Kinder-Prostitution im besonderen. (Letzteres ist ja inzwischen ein ganz "normaler" Beruf; fragt unsere Gesetzgeber - oder würdet Ihr es etwa wagen, die Weisheit der Parteibonzen, die im Bundestag Sessel pupsen, und die Güte dessen, was dabei hinten raus kommt, anzuzweifeln?) Dikigoros hat sich seine Meinung zu diesem Thema in zahlreichen Diskussionen in Indien gebildet, die allesamt wieder zu geben hier zu weit führen würde; er will versuchen, Euch das Ergebnis etwas kürzer gefaßt zu präsentieren. Was Dikigoros davon hält, kleinen Kindern an staatlichen Bildungsanstalten abstraktes Wissen einzubleuen, schreibt er etwas ausführlicher an anderer Stelle; wenn die Alternative also lautet "Schule oder Ruinenfeld" würde er allemal das letztere vorziehen, denn was die Kinder in ersterer lernen, davon können sie nicht abbeißen - wohl aber von dem Geld, das sie auf letzterem verdienen. Wozu dient denn die Schule, liebe Leser? Im Westen erstens dazu, die Kinder aus dem Haus zu bekommen, damit ihre Mütter arbeiten gehen und Geld verdienen können (man braucht schließlich den Zweitwagen, die Zweitwohnung und den Zweiurlaub auf Mallorca!), zweitens um zu verhindern, daß sie sich auf der Straße herum treiben und kriminell werden, und drittens - aber wirklich nur an letzter Stelle -, um sie aufs Leben im allgemeinen und aufs Berufsleben im besonderen vorzubereiten, wobei der Zweck des letzteren natürlich nicht die Berufung ist, eine bestimmte Tätigkeit auszuüben, wie man angesichts der mißverständlichen deutschen Bezeichnung meinen könnte, sondern der Job, mit dem man irgendwie Geld verdient.
Wenn man das einem Inder erzählt, fragt der nur ungläubig zurück: Wozu denn dann der Umweg über die Schule? Unsere Frauen gehen eh nicht arbeiten, wenn sie kleine Kinder haben, die wiederum haben eh keine Zeit, sich auf der Straße herum zu treiben, und warum für einen Beruf lernen, den man schon so ausüben kann? Learning by doing - ist das nicht auch im Westen jetzt die Devise? Im übrigen ist es ein Märchen, daß die Kinder lieber in die Schule als zur Arbeit gehen würden. Arbeit macht Spaß, und wenn sie einigermaßen Geld einbringt auch stolz; Schule dagegen ist langweilig und mit großen Anstrengungen und Unlustgefühlen verbunden - für die körperliche und geistige Gesundheit eines Kindes ist eine Berufstätigkeit wie hier im idyllisch gelegenen Ruinenfeld - viel Bewegung an frischer Luft, verbunden mit geistig anregenden Gesprächen - zehnmal besser, als sich in der Schule von einem blöden Lehrer dummes Zeug erzählen zu lassen, es auswendig zu lernen und nachzuplappern, in den meisten Fällen, ohne es verstanden zu haben. Für Schulkinder sind z.B. Namen und Daten der Geschichte Schall und Rauch: ein paar Buchstaben und Zahlen, unter denen sie sich kaum etwas vorstellen können; aber wer den ganzen Tag selber in den Ruinen einer alten Stadt herum klettert und jeden Stein kennt, dem sagt auch ihre Geschichte etwas - er plappert dem Touristen nicht einfach nur etwas vor. Das gilt übrigens nicht nur für geistige Tätigkeiten, sondern auch für handwerkliche: Die von Marx und Engels - zurecht - so beklagte "Entfremdung" des Menschen von seiner Arbeit findet nicht in den viel geschmähten Fabriken statt (denn selbst am Fließband bekommt man ja noch mit, wie ein Produkt entsteht und wächst), sondern in den Schulen, die verhindern, daß Kindern ihren Eltern bei der Arbeit zuschauen können.
Gewiß, es gibt auch weniger schöne Tätigkeiten, vom Steinchenklopfen bis zum Teppich-Knüpfen in der Manufaktur (Kinderhände sind nun mal bei so etwas geschickter als die der Erwachsenen), aber auch das letztere ist in der Regel keine Sklavenarbeit (ebenso wenig wie das Pflücken von Kakaobohnen auf den Plantagen Ghanas und der Elfenbeinküste, das neuerdings so bezeichnet wird von Leuten, die uns ein schlechtes Gewissen machen wollen, wenn wir Schokolade essen oder trinken), sondern die kleinen Arbeiter[innen] reißen sich vielmehr um diese relativ gut bezahlten Jobs. (Natürlich ist das nur ein Job, keine Berufung, aber man muß ja sehen, wo man bleibt!) Nun gibt es einen Job, in dem man so jung, so schnell, so viel Geld verdienen kann wie sonst in keinem anderen. Dikigoros ist, wie die meisten seiner Leser schon wissen, als altmodischer Mensch kein Freund dieses Jobs, aber er steht mit dieser seiner ablehnenden Haltung zunehmend allein auf weiter Flur. Die Prostituierten tun es - wiederum entgegen weit verbreiteter Märchen - zu 99,9% freiwillig und gerne, jedenfalls solange sie ordentlich Geld damit machen, denn es gibt wie gesagt keine andere auch nur annähernd so leichte und bequeme Art, schnell viel Geld zu verdienen. Für die Zuhälter und Puffmütter - meist selber ehemalige Prostituierte - gilt das gleiche: Womit sonst...? Auch die Freier sind's zufrieden: Wenn man sich mal ausrechnet, was eine Ehefrau oder ein schwuler Lebensgefährte mit Trauschein (auch das gibt es ja inzwischen :-) so kostet - vor allem, falls es zur Scheidung kommt, und die Wahrscheinlichkeit steigt ja immer mehr an - kommt es immer noch billiger, seine sexuellen Bedürfnisse auf dem Strich oder im Puff zu stillen.
Auch die Politiker haben inzwischen erkannt, welch lukratives Geschäft sie sich durch die Lappen gehen lassen, wenn sie diesen Erwerbszweig in die Illegalität und damit in die Schwarzarbeit abdrängen: Steuern- und Sozialabgaben-Ausfall in Milliardenhöhe! Nein, da macht sich Dikigoros keine Freunde mit seiner ständigen Kritik... und schon gar nicht mit seiner Ablehnung des Prostitutions-Tourismus. Das ist es doch gerade, weshalb die meisten Reisenden nach Thailand, auf die Filippinen, nach Brasilien, in die Dominikanische Republik und sonst wohin jetten - dieses harmlose Vergnügen will er ihnen verderben? Und ist es nicht die reinste Entwicklungshilfe am rechten Ort, die garantiert ankommt: nicht bei den staatlichen Behörden und Regierungs-Bonzen, die sie doch nur veruntreuen, sondern bei den ärmsten der Armen, denen aufgrund ihres gehobenen Einkommens sogar ein schöner gesellschaftlicher Aufstieg winkt?! Auch die Regierungen den "Empfängerländer" sehen das insgeheim so - wenngleich sie nach außen hin das Gegenteil beteuern. Für wie viele Länder der Dritten Welt, die nicht regelmäßig Überweisungen von Gastarbeitern und Asylanten aus den reichen Ländern des Westens beziehen, ist denn der Prostitutions-Tourismus nicht die größte Devisen-Einnahmequelle? Dikigoros kennt keines... aber er wird sich nicht von der Auffassung abbringen lassen, daß diese Art von "Entwicklungshilfe" das Sozialgefüge der betroffenen Staaten von Grund auf ruiniert: Wenn Prostitution mit Ausländern zum Volkssport wird - wie z.B. in Thailand - und so viel Geld einbringt, daß sich "anständige" Arbeit nicht mehr lohnt, stellen die Leute die letztere eben ein und leben nur noch davon, ihre Frauen und Töchter auf den Strich oder in die Bar zu schicken. Und für alle, die glauben, ach so sozial zu denken: Die einheimische Bevölkerung kann sich dann ob der durch Ausländer verdorbenen Preise einen Besuch im Puff kaum noch leisten, und damit entfällt die einzige Rechtfertigung, welche die Prostitution dort sonst traditionell haben könnte: sie kann kein Ventil für Ehestreß innerhalb der Bevölkerung mehr sein.
![[Sextourismus]](sextourismus.jpg)
![[Yellamma]](yellama.jpg)
Eine merkwürdige, heuchlerische Ausnahme machen die grundsätzlichen Befürworter der Prostitution mit der so genannten "Kinder-Prostitution", und mit besonders hoch erhobenem moralischem Zeigefinger reagieren sie auf eine Erscheinung, die in Indien eine lange Tradition hat, nämlich die "Dewdāsīs [Gottesdienerinnen (im Westen meist "Devadasis" geschrieben)]" in den Tempeln der Göttin "Yellamma" (die auf Hindī auch "Renukā" genannt wird). Nun gab es so etwas zwar früher auch in den alten Gesellschaften, auf deren kulturelles Erbe sich die Europäer so gerne berufen - Mesopotamien, Ägypten, Griechenland, Rom -, aber erstens gibt es das heute ja nicht mehr (jedenfalls nicht mehr offiziell, und wenn, dann nicht mehr im Tempel), und zweitens huldigen die Geschichts-Professor[inn]en der Auffassung, daß es keine Minderjährigen betroffen hätte. So so, Ihr glaubt also, damals hätte man dafür keine jungen Mädchen, sondern alte Omas genommen? Träumt weiter... Was stört Euch denn so? Prostitution an sich? Da seid Ihr doch sehr für, wie wir eben gesehen haben. Sex mit Minderjährigen? Come on, da seid Ihr insgeheim auch für, und warum auch nicht? In den USA haben sie das Alter für die Zustimmung inzwischen auf 11 Jahre gesenkt, und bei den alten Chinesen, Griechen und Römern - halt in den Wohlstands-Gesellschaften, in denen die Kinder schnell wuchsen und geschlechtsreif wurden - lag es auch da. (In Japan ist Sex mit Minderjährigen schon immer erlaubt gewesen - und heutzutage geradezu Kult.) Wer geschlechtsreif ist und Sex haben will, soll ihn haben - früh übt sich, und aus selbst gemachten Fehlern lernt man bekanntlich am meisten. Kurzum: Sex mit 11-17-jährigen, die geschlechtsreif sind, ist kein Kindersex, und früher werden auch die indischen Mädchen der Yellamma nicht "geweiht".
![[Dewdasi]](dewdasiyellamma.jpg)
![[Dewdasi]](dewdasi.jpg)
Ihr meint, in so einem Sex-"Kloster" zu leben, sei ein besonders armseliges Dasein unter besonders brutalen Bedingungen? Weit gefehlt, liebe Leser, den Dewdāsīs geht es materiell weit besser als dem Durchschnitt der jungen Inderinnen; und das Klosterdasein ist nun mal härter als ein "normales" Leben, schon wegen der strengen Disziplin - aber auch das ist überall auf der Welt so, nicht nur in Indien. [Dikigoros nimmt die siamesischen Kindergärten, die sich "buddhistische Klöster" nennen, ausdrücklich aus - dort wird nur "Sanuk" gemacht.] Ihr meint, schon die Aufnahme-Zeremonie sei schmerzhaft und entwürdigend? Wart Ihr mal dabei? Dikigoros auch nicht, denn da dürfen nur Eingeweihte zuschauen. (Es geht nicht darum, ob In- oder Ausländer; aber da der Staat Karnataka die Tempel-Prostitution der Dewdāsīs anno 1982 verboten hat, muß halt alles unter großer Geheimhaltung statt finden.) Aber er hat die Einweihungs-Zeremonie in Shrawan Belgolā, dem größten Heiligtum der Jainen in Süd-Indien, gesehen - da sind Zuschauer willkommen, denn es gilt ja nicht als unanständig, sondern vielmehr als äußerst schön und angenehm. Meint Ihr wirklich? Die Mädchen werden ausgezogen und dann von Kopf bis Fuß gerupft, wie Hühner. Nein, nicht geschoren, rasiert oder epiliert, sondern die Haare werden ihnen Büschel für Büschel von älteren Frauen ausgerissen (nur die letzten Strähnen lassen sie stehen - die werden dann von nackten alten Männern, den Ober-Digambaren, höchstpersönlich ausgerissen, eine besondere Ehre für die Novizinnen); das dauert etwa eine halbe Stunde, dann sind sie "Nonnen" und dürfen nun nie im Leben einen Mann haben - außer den steinernen Heiligen. Glaubt Ihr wirklich, liebe Leser[innen], dieses Schicksal sei beneidenswerter als das der Dewdāsīs? Die letzteren finden jedenfalls nach ein paar Jahren, in denen sie eine ordentliche Mitgift ansparen können, problemlos einen Ehemann, denn ihre Tätigkeit gilt - anders als die der echten Prostituierten in den Puffs von Bãbaī und anderen Städten - nicht als unehrenhaft. Wieso auch? Die Namensgeberin war eine Ehebrecherin, die ihr Ehemann zur Strafe hinrichten ließ - durch ihren eigenen Sohn, der danach freilich zu Agni betete, er möge sie wieder auferstehen lassen. So geschah es denn, und durch die Verbrennung waren alle bösen Taten von ihr genommen - auch der Ehebruch -, und sie lebte wieder glücklich und zufrieden als gute Ehefrau; und genauso ist es mit ihren modernen Dienerinnen auch. Was stört Euch an der Geschichte? Das läuternde Feuer? Ach - und wie war das gleich mit Eurem Fegefeuer? Dikigoros' Fazit: Besser geregelte Tempel-Prostitution für ein paar eingeweihte Einheimische, als das ganze Land wird zum Hurenhaus für ausländische Touristen. Exkurs Ende.
![[Shrawan Belgola]](shrawantirt1.jpg)
![[steinerner Heiliger (Tirthankar) in Shrawan Belgola]](shrawantirt.jpg)
Wenn Ihr an dieser Stelle einen touristischen Abstecher nach Gowa - oder wie Ihr es wahrscheinlich schreibt "Goa" - erwartet, liebe Leser, dann muß Dikigoros Euch enttäuschen - es wird nicht mehr als eine moralische Standpauke werden. Gowa mag zwar inzwischen zum beliebtesten Ziel ausländischer Reisender in Indien avanciert sein (wenn man denn hier von "avanciert" sprechen kann - aber was wird uns nicht heutzutage alles als "Fortschritt" verkauft) und weiter als solches hoch gejubelt werden, aber... Dikigoros hat die ehemalige portugiesische Kolonie an der Konkani-Küste noch in einer idyllischen Zeit kennen gelernt, als man die Hippies gerade hinaus geworfen und der Devisen-Tourismus noch nicht Einzug gehalten hatte, zudem ganz außerhalb der Saison. Die Strände waren so toll nicht (das sind indische Strände nirgends), vielmehr ziemlich schmutzig - aber das war noch natürlicher Schmutz. Nein, Dikigoros meint auch nicht das, was Moral-Apostel für "Schmutz" halten - über Sex mit "Kindfrauen" hat er ja gerade geschrieben, und den Sex mit Lustknaben haben die Muslime hier schon seit Jahrhunderten praktiziert, lange bevor die ersten schwulen Touristen kamen. Aber nun versucht man, die Küste zum Badeurlaubs-Zentrum auszubauen, und das ist geradezu ein Verbrechen, denn inzwischen hat Indien dort allenthalben Atomkraftwerke gebaut, die ihre Abwässer ungeniert in den Indischen Ozean verklappen. Gewiß, die stehen überwiegend weiter südlich, an der Malābār-Küste; aber der Skandal ist ja, daß der Bade-Tourismus à la Goa, der sich früher kaum weiter südlich als Panaji abspielte - "Calangute Beach" war berühmt-berüchtigt -, nun immer weiter ausgedehnt wird; und bald wird er mit dem anderen künstlichen Badeurlaubs-Zentrum, "Kovalam Beach" bei Trivandrum in Keral, zusammen wachsen und eine durchgehende Touristen-Badeküste hergestellt sein. Denn auch Keral ist ja so schön christlich und so schön kommunistisch (und braucht daher, nach Jahren wirtschaftlicher Scheinblüte, dringend die harten Devisen der ausländischen Touristen), und vor allem gibt es, anders als im Rest Indiens, so viel Alkohol wie das Herz (und die Leber) begehrt: Der einheimische "Fani" (anglisiert auch "Fanny" geschrieben) [eine Art Whisky, der bessere wurde früher aus den teuren Cashew-Nüssen gebrannt; heute nimmt man meist die billigeren Kokosnüsse] floß schon immer in Strömen (Dikigoros erinnert sich noch, wie gleich beim Überqueren der Grenze nach Gowa Sprit-Händler im Knabenalter den Zug stürmten und ihr Zeug anboten - auch er hat es probiert, aus Neugier, weil alle anderen es auch kauften wie wild, vielleicht sogar nur deshalb angereist waren :-), und inzwischen gibt es für zahlungskräftige Ausländer, denen es das wert ist, auch teurere Importware. Bald wird es aussehen wie auf anderen "Inseln" des Devisen-Tourismus, wo die Ausländer von den Inländern streng abgeschottet werden müssen, damit erstere die Moral nicht ganz verderben (und letztere sie nicht überfallen und totschlagen - sei es aus moralischer Entrüstung oder aus Habgier, denn mit dem Respekt sinkt auch die Hemmschwelle, Hand an sie zu legen), wie in der Karibik oder nebenan, auf den Lakkadiwen. Nein, Dikigoros ist schon lange nicht mehr dort gewesen; er wollte sich die Erinnerung nicht verderben an die Zeit, als westliche Pauschal-Touristen noch völlig absent waren, und als die arabischen Touristen noch nicht in erster Linie wegen der Mädchen kamen wie heute (übrigens nicht nur der Inderinnen - und der nepalesischen Gastarbeiterinnen, die inzwischen das Prostitutions-Gewerbe beherrschen -, sondern auch der westlichen Frauen, die leichte Beute und zudem noch kostenlos zu haben sind), sondern wegen der Regenfälle im Mausam (den Ihr als "Monsun" zu kennen glaubt, obwohl westliche Touristen ihn grundsätzlich meiden, zumal die Massenmedien ja von Jahr zu Jahr schlimmere Katastrofen-Meldungen von Überschwemmungen, Ertrunkenen und Seuchen verbreiten), die auf Wüstensöhne (arabische Frauen kommen nur selten mit, und wenn, dann zeigen sie sich nicht in der Öffentlichkeit, sondern bleiben im Hotel) einen ganz besonderen Reiz ausüben. Und wegen des Alkohols, der bei ihnen zuhause verboten ist. Aber ist das eigentlich eine Sünde? Der Qur'ān verbietet doch ausdrücklich nur "Sharāb", also aus Weintrauben gewonnen Alkohol. Fani fällt nicht darunter, und Bier und Whisky auch nicht. Früher gab es auch noch Hummer, und es gibt ihn immer noch; aber erstens ist er wie gesagt atomar verseucht und zweitens unerschwinglich geworden, jedenfalls in den "Spezialitäten-Restaurants" für Touristen, und an andere wird er nicht mehr ausgeliefert - lohnt sich doch nicht, wenn man an ersteren so gut verdient.
Enttäuscht, liebe Leser? Ach was, laßt Euch nichts einreden - Gowa ist nicht Indien, und wenn Dikigoros oben die Städte Bãbaī und Warānsī als "Sodom und Gomorrha" von Bhārat bezeichnet hat, dann ist Gowa heute sein Nevada. Und das ist es eben, was Dikigoros so stört: Die Kommerzialisierung des Zwischenmenschlichen, denn es verdirbt nicht nur den Charakter des einzelnen, sondern es zerstört auch das Sozialgefüge einer Gesellschaft - von der Familie über den Gotr bis zur hinauf zur Jati -, wenn ein Schuhputzer oder eine Prostituierte in einem Touristenhotel soviel mehr verdient als jemand, der einer traditionellen und durchaus ehrenwerten, aber eben im Vergleich dazu nur schlecht bezahlten Arbeit nachgeht. In Bundelkhand hatte Dikigoros sich noch Gedanken gemacht, ob es richtig sei, Kindern für ihre Dienstleistungen im Ruinenfeld 5 Rupyen zu geben, dabei war das doch wirklich harmlos, auch in seinen Auswirkungen; in Gowa dagegen machen sich andere Touristen aus dem Westen - Arabien, Europa und Amerika - keine Gedanken, Kindern für ihre Dienstleistungen im Hotelbett 500 Rupyen zu geben; und das sprengt eben den Rahmen dessen, was man noch "harmlos" nennen kann. Dikigoros hat diesen Punkt auch mal mit Melone erörtert. Der meinte vorab, das bekäme man nach seinen Erfahrungen auch als Westler schon für 100 Rupyen; dann mache er sich nichts aus kleinen Jungen oder Mädchen, sondern ziehe erwachsene Frauen vor, vor allem solche mit Kleinkindern, die hätten es am ehesten nötig, es billiger zu machen und würden sich auch nicht so anstellen; und schließlich sei es immer noch besser, die Kinder auf den Valuta-Strich zu schicken als, wie es früher üblich war, sie zu verstümmeln und als Einarmige oder Einbeinige zum Betteln auf die Straße zu schicken... Daran mag einiges richtig sein; aber seit Melone die Löffel abgegeben hat, fragt sich Dikigoros doch, ob es nicht immer noch besser ist, als Krüppel zu leben, als jämmerlich an AIDS zu sterben oder, um seine Leiden abzukürzen, Tabletten zu nehmen; jedenfalls hat er noch keinen indischen Bettler Selbstmord begehen sehen. (Wenn ihm jetzt Melones Geist im Traume erschiene, würde der wahrscheinlich sagen: "Weil die Bettler sich keine teuren Tabletten leisten können, denn du gibst denen ja immer nur Aluchips; ich habe dagegen meine Frauen immer anständig bezahlt.") Wie dem auch sei, liebe Leser, wenn Ihr Indien kennen lernen wollt, wie es wirklich ist - jedenfalls an den meisten Orten -, dann fahrt woanders hin als nach Gowa oder benutzt es nur als Ausgangspunkt für eine Reise gen Osten zu den vom Ausländern-Tourismus noch fast unbeleckten Orten Hubli und Dhārwād, Hospet und Hampi oder Belgaum und Saudatti (dort steht der gerade erwähnte Yellamma-Tempel). Aber Vorsicht - das ist ein Trip für Hartgesottene, nicht für "Qualitäts-Touristen", wie sie für gewöhnlich zum Badeurlaub nach "Goa" fliegen!
Aber Dikigoros will Euch an dieser Stelle von einem anderen Abstecher erzählen, den er zusammen mit Melone gemacht hat, weil der unbedingt irgend ein schwer zugängliches Bauwerk in Mittelindien besichtigen wollte. Es ist mal wieder spät geworden ("es" ist der verspätete Überland-Bus) und vor allem dunkel, so daß sie beschlossen haben, erstmal in der nächsten Stadt zu übernachten. Nicht weit vom Busterminal steht ein Hotel, das Dikigoros sympathisch ist: Zwar direkt an der Hauptstraße, aber von dieser getrennt durch einen weitläufigen Hof, der mit kühlenden Bäumen bestanden ist, und einer Vorhalle, in der, den Plakaten nach zu urteilen, laufend allerlei interessante Veranstaltungen statt finden. "Laut Reiseführer soll es hier aber bessere und vor allem billigere Hotels geben," meint Melone naserümpfend. Aber Dikigoros ist müde: "Willste etwa jetzt noch auf die Suche gehen? Und nachher sind die alle ausgebucht. Wir können hier ja wenigstens mal fragen." Aber noch bevor sie jemanden fragen können, kommt ihnen schon ein subalterner Portier entgegen gewieselt und sagt ihnen in gebrochenem Englisch, daß sie komplett belegt seien. Dikigoros wirft einen Blick aufs Schlüsselbord und weiß sofort, daß das nicht stimmt. "Wo ist dein Boss?" - "Boss nicht da, werde schicken holen." - "Gut, ich werde sitzen warten," sagt Dikigoros, nimmt in der Lobby Platz, läßt sich einen Tee bringen und beginnt Reisetagebuch zu schreiben. Nach einer halben Stunde ist Melones Geduld erschöpft: "Ich gehe jetzt ins 'Ratna', wir treffen uns morgen früh dort in der Cafeteria, hier kann man ja wohl nichts zu essen bekommen." Sagt's und macht sich aus dem Staub. Dikigoros trinkt noch eine Kanne Tee (die beiden Kannen werden ihm am letzten Tag mit auf die Rechnung gesetzt, aber ganz korrekt), und irgendwann kommt tatsächlich der Hotelinhaber höchst persönlich - man hat ihn zuhause aus dem Bett geworfen. "Wir sprechen hier kein Englisch," sagt er auf Hindī. "Das trifft sich gut," gibt Dikigoros trocken auf Hindī zurück, "ich auch nicht; ich bin Deutscher." Kurze Pause. "Ich kann Ihnen wirklich nur für heute Nacht ein Zimmer geben, morgen punkt 12 Uhr müssen Sie raus, wir erwarten den Wiederverheiratungs-Kongreß." - "Den was?" - "Den Kongreß der Geschiedenen und Verwitweten, die wieder heiraten wollen." - "Ist das so etwas wie ein Heiratsmarkt?" - "Nein, so etwas gibt es bei uns nicht, jedenfalls nicht offiziell. Aber wenn sie so wollen, es lernen sich da jedenfalls Leute kennen, die wieder heiraten wollen; es ist erst die zweite Veranstaltung dieser Art überhaupt; sonst haben wir hier Hochzeitsfeiern oder andere Kongresse." Hm... das ist ja hochinteressant, denkt Dikigoros, das würde sicher auch Melone interessieren - aber wie erreicht er den jetzt? "Kann ich mal kurz im Hotel 'Ratna' anrufen? Dort logiert ein Freund von mir." - "Bitte, das mache ich doch gerne für Sie. Wie heißt er denn?" Aber im Hotel 'Ratna' ist Melone nie angekommen, weder heute noch morgen (wie Dikigoros später erfährt, ist er woanders abgestiegen), und so ist es wohl auch müßig, sich am nächsten Morgen dorthin zu bemühen. Egal, der wird seine Sehenswürdigkeit auch alleine finden.
Am nächsten Tag, kurz vor 12 Uhr, kommt Dikigoros an die Rezeption, wo es wie in einem Bienenstock zugeht. Er hat schon gepackt und will auschecken, da kommt ihm ein Paar entgegen, das offensichtlich den angesagten Kongreß leitet. "Sie haben es weit gebracht," pflaumt er sie an, "jetzt werden schon die Geschiedenen meistbietend verhökert." - "Das sind keine Geschiedenen," sagt der kleine, untersetzte Mann nicht ohne Würde, "das sind böswillig Verlassene." Er überreicht Dikigoros seine Karte und eine Veranstaltungs-Broschüre. Tatsächlich, so steht es da in schönstem Hindī ausgedru[e]ckt - hübsche Umschreibung, denn schuld an einer Scheidung sind ja immer die anderen. (Wenn man über Jahre hinweg indische Heirats-Annoncen aufmerksam liest, wie Dikigoros das tut, dann stellt man fest, daß sich die Wortwahl auch im indischen Englisch stark gewandelt hat, hin zum Beschönigenden, was vor allem für Auslandsinder[innen], die diese Entwicklung nicht mitbekommen haben, peinlich sein kann: Wer unter Familienstand "single" schreibt, meint damit nicht - wie in den USA oder England - "Junggeselle" oder "Junggesellin" [das heißt jetzt auf Hindinglish "never married"], sondern "geschieden" (oder jedenfalls nicht mehr jungfräulich); und das ist fast noch schlimmer als "widowed" - es sei denn, die Witwe hätte Kinder, insbesondere Töchter, die noch nicht verheiratet und/oder versorgt sind. [Dagegen wird das Wort "spinster" - das im Westen den negativen Beigeschmack von "alter Jungfer" hat, in Indien durchaus neutral verwendet, halt für eine noch nie verheiratete Frau, die die Mitte 20 schon überschritten hat.] Selbstverständlich muß auch angegeben werden, ob Geschwister vorhanden sind, wiederum nach Geschlechtern aufgeteilt, und bei Schwestern, ob sie verheiratet sind. Nun ja, liebe Leser, das ist wenigstens ehrlich - wenn man es denn zu lesen weiß -, während die umgekehrte Entwicklung bei uns ist nicht gerade geeignet ist, für Aufklärung zu sorgen. Früher wurde ein noch nie verheiratetes weibliches Wesen "Fräulein" genannt, ein verheiratetes "Frau" und ein verwitwetes "Witwe" - Dikigoros erinnert sich noch, daß die Vermieterin seiner Studentenbude ihre Briefe mit "Witwe Elizabeth F..." zu unterschreiben pflegte; und er selber schrieb dementsprechend in die Adreßzeile seiner Antwortbriefe nicht "Frau..." sondern "Wwe", so wie er seine Schwester mit "Frl." adressierte. Heutzutage wird alles in den Topf "Frau" geworfen, ein Ausdruck, der völlig nichtssagend geworden ist - während sich die unverheirateten amerikanischen Emanzen mit der Neuschöpfung "Ms" selber ins Knie geschossen haben, denn das wird nun anstelle von "Miss" verwendet - verheiratete Frauen bezeichnen sich weiterhin als "Mrs." :-)
"Ist es nicht sehr schwierig, in solchen Fällen einen neuen Partner zu finden?" fragt Dikigoros - "Oh ja, wem sagen Sie das, und selbst diejenigen, die sich hier bei uns treffen, haben ja noch keine Garantie, daß es mit der Wiederverheiratung wirklich klappt. Sie kennen ja nur ein Foto und ein paar Daten aus dem Katalog, was besagt das schon für ein Leben zu zweit?!" - "Mein Freund sucht auch gerade ein Frau, ob er sich das wohl mal anschauen dürfte?" - "Ist Ihr Freund Vegetarier?" (Auch noch wählerisch! Ob das die Chancen auf Wiederverheiratung erhöht?) "Nein." - "Dann hat es keinen Zweck; wir verkehren nur mit anständigen Menschen." - "Wieso können Nicht-Vegetarier keine anständigen Menschen sein?" - "Weil sie, um zu essen, ohne Not fremdes Leben töten." - "Pflanzen leben auch; wo wollen Sie die Grenze ziehen?" - "Bei Mitlebewesen, wie es Tiere sind." - "Aber nicht alle. Ich esse Fisch, Geflügel und Eier, weil ich der Auffassung bin, daß Fische und Vögel nicht meine Mitlebewesen sind; wir Menschen sind Säugetiere, und die esse ich nicht." - "Das ist interessant. Wie wäre es, wenn Sie noch etwas bleiben und sich unseren Kongreß anschauen?" - "Ich bin schon verheiratet." - "Und wo ist Ihre Frau?" - "Die traut sich nicht nach Indien, ich habe ihr zuviel darüber erzählt." - "Oh, haben Sie ihr soviel Schlechtes über unser Land erzählt?" - "Das ist schwer zu erklären. [Dikigoros hütet sich zu erzählen, daß seine Frau schon zum Frühstück rohen Schinken ißt und auch auf Milch und Malzbier nicht verzichten wollte - all das ist in Indien praktisch nicht zu bekommen und könnte, etwa im Gegensatz zu Gummibärchen und Kartoffel-Chips, auch nicht in ausreichenden Mengen mitgenommen werden. (Sein Gesprächspartner ist Jain; als solcher darf er nicht mal Kartoffeln essen, weil beim Ausgraben Regenwürmer verletzt werden könnten :-)] Aber die würde mir etwas anderes erzählen, wenn ich sie z.B. nach einer anstrengenden, ganztägigen Busfahrt über Stock und Stein in ein Hotel brächte, wo wir so unfreundlich empfangen und am nächsten Tag schon wieder auf die Straße gesetzt werden." - "Wer setzt Sie auf die Straße?" - "Na, der Inhaber." - "Einen Moment mal, warten Sie." Fünf Minuten später kommt er zurück: "Alles ein bedauerliches Mißverständnis, Sie können Ihr Zimmer selbstverständlich behalten, ein paar von unseren angemeldeten Teilnehmern sind nicht erschienen." - "Und wenn sie noch erscheinen?" - "Rücken wir zusammen. Sie sollten unbedingt noch zwei Tage bleiben und sich unseren Kongreß anschauen." Da sagt Dikigoros nicht nein - und es werden mit die interessantesten Tage, die er je in Indien erlebt hat, denn er führt fast pausenlos Gespräche mit allen möglichen und unmöglichen Teilnehmern, die er hier ebenfalls nicht in volle Länge wiedergeben kann, aber einige sind so wichtig, daß er sie seinen Lesern nicht vorenthalten will.
Nachdem er sich in Khajurāho so mit seinen Thesen zur Eheschließung blamiert hat, geht Dikigoros diesmal etwas vorsichtiger zu Werke, als er sieht, daß die Vermittlungsquote doch arg bescheiden ist: "Wieso ist es eigentlich so schwierig, verwitwete Männer und Frauen [die Geschiedenen läßt er taktvoll beiseite] wieder zu verheiraten? Zumal wenn sie z.T. doch noch relativ jung und manchmal sogar kinderlos sind?" - "Ja, das ist ein Problem; offen gestanden würde ich auch nicht unbedingt..." - "Ja, aber warum nicht?" - "Würden Sie eine gebrauchte Frau heiraten?" - "Äh..." - "Also auch nicht." - "Das habe ich nicht gesagt." - "War Ihre Frau unberührt?" - "Als ich sie kennen lernte ja; aber ich hätte doch nicht die Katze im Sack gekauft." - "Was meinen Sie damit?" [Im Hindī gibt es keine entsprechende Redensart; das Wörterbuch braucht drei Zeilen, um die englische Entsprechung "ein Schwein im Gedränge kaufen" zu erklären.] "Nun, bevor man heiratet sollte man doch sehen, ob man auch im Bett miteinander harmoniert." - "Glauben Sie wirklich, daß das in einer Ehe das wichtigste ist?" - "Nein, aber ohne das geht es eben auch nicht." - "Warum sollten zwei gesunde, normal veranlagte Menschen, die guten Willens sind, nicht im Bett miteinander können? Haben Sie auch vorher ausprobiert, ob Ihre künftige Frau kochen und einen Haushalt führen kann?" - "Äh... nein." - "Dann haben Sie also doch die Katze im Sack gekauft. Oder finden Sie nicht, daß das ebenso wichtig gewesen wäre?" - "In meinem Falle nicht, ich koche selber." - "Das sind doch Ausreden. Ich verstehe nicht, daß es im Westen Männer gibt, die Frauen heiraten, die schon ein Dutzend anderer Männer vor ihnen gehabt haben." - "Meine Frau würde Sie jetzt fragen: und umgekehrt?" - "Natürlich auch nicht. Eine Braut hat ebenso Anspruch auf einen unverbrauchten Ehemann." - "Wir glauben, daß es besser ist, wenn man - und frau - sich die Hörner vor der Ehe abstoßen als wenn sie während der Ehe glauben, etwas versäumt zu haben und fremd gehen." - "Glauben Sie, daß Ihre Frau Sie schon mal betrogen hat?" - "Nein, ich gebe ihr ja auch keinen Grund dazu. Im übrigen finde ich es viel wichtiger, daß sie nicht raucht, nicht trinkt und sich nicht die Vampe voll frißt wie andere Frauen, die zehn Jahre nach der Heirat doppelt soviel wiegen wie vorher."
"Sie haben vielleicht Sorgen; in Indien gibt es Menschen, die froh sind, wenn Frau und Kinder zehn Jahre nach der Heirat nicht verhungert sind." - "Kein Wunder, wenn sie sich immer nur von Dāl und Wasser ernähren." (Alle tun das auf dieser Veranstaltung - auch Dikigoros läßt es sich höflichkeitshalber aufnötigen, obwohl er den Linsenbrei nicht mag und das lauwarme Wasser ihm nicht sonderlich sauber erscheint.) "Dāl enthält alle notwendigen Nahrungsstoffe, auch vom Menschen verwertbares Eiweiß." (Was der gute Mann nicht erwähnt - wenn er es denn weiß, Dikigoros selber hat es erst Jahre später erfahren - ist, daß es auch Metaxylohydrochinon enthält, einen Stoff, der die Fruchtbarkeit bei Männlein und Weiblein gleichermaßen herab setzt; da die Jainen das Zeug fast täglich essen, haben sie weniger Kinder als andere Inder, was einerseits zu ihrer geringen Anzahl, andererseits zu ihrem verhältnismäßigen Reichtum geführt haben mag.) "Aber wir sind vom Thema abgekommen. Sie sagten, Sie glauben nicht, daß Ihre Frau Sie schon einmal betrogen hat, obwohl sie ja nach Ihrer Auffassung glauben könnte, daß sie etwas versäumt hat. Aber wenn das bei Ihnen eine Glaubensfrage ist: Was sagt denn Ihre Religion dazu? Was sind Sie?" - "Katholik." - "Ach, ist es nicht so, daß auch Ihre Kirche erwartet, daß die Frau unberührt in die Ehe geht?" - "Theoretisch schon." - "Und praktisch?" - "Nun ja, praktisch wird die Religion bei uns im Westen halt nicht mehr ganz so ernst genommen." - "Finden Sie das gut und richtig?" - "Ich weiß nicht." - "Waren Sie mal in Bãbaī?" - "Ja, vor Jahren." - "Es wird jedes Jahr schlimmer. Dort können Sie sehen, was dabei heraus kommt, wenn die Religion nicht mehr ernst genommen wird, mit all der Unmoral und den Gewaltverbrechen. Das liegt an den vielen schlechten Filmen, die im Kino und im Fernsehen gezeigt werden. Ich möchte dort nicht leben; und ich werde auch meine Kinder so erziehen, daß sie davor bewahrt werden und glückliche, zufriedene Kleinstadt-Bewohner werden." (Er hat einen Jungen und ein Mädchen im Alter von etwa 10 Jahren, die beide auch anwesend sind.) "Aber sagen Sie mal, haben Sie nicht den Eindruck, daß die Vermittlungsquote auch deshalb so gering ist, weil hier nicht die potentiellen Ehepartner alleine entscheiden, sondern die ganze mit angereiste Verwandschaft ihre Finger im Spiel hat?" - "Ach, jetzt kommt wieder das westliche Vorurteil, daß hier in Indien die Eltern ihre Kinder ungefragt verheiraten." - "Nein, ich habe durchaus Verständnis dafür, daß Eltern ihren Kindern bei der Partnerwahl helfen, besonders wenn die noch sehr jung sind; ich habe meine Eltern auch vorher gefragt, und wenn sie nein gesagt hätten, hätte ich meine Frau nicht geheiratet. Aber das hier sind doch erwachsene, Ehe-erfahrene Menschen - wozu brauchen die noch den Rat und die Einmischung von Eltern, Geschwistern, Onkeln und Tanten?"
"Wollen Sie denn, daß ständig Unfrieden in der Familie herrscht, weil sich einige Verwandte und Verschwägerte nicht vertragen?" - "Warum sollen gesunde, normal veranlagte Verwandte und Verschwägerte, die guten Willens sind, sich nicht miteinander vertragen?" zitiert Dikigoros seinen Gesprächspartner. - "Wie ist das denn bei Ihnen?" - "Nun, meine Frau und meine Eltern haben sich immer gut verstanden; und meine Schwiegereltern wohnen weit weg, die sehe ich vielleicht dreimal pro Jahr, meine Schwägerin und ihre Familie noch seltener." - "Finden Sie diesen geringen Zusammenhalt der Familien gut?" - "Ich weiß nicht; wahrscheinlich haben wir im Westen da wirklich ein Defizit; aber man kann es auch umgekehrt übertreiben, wie hier in Indien." - "Die Familien sind hier das soziale Netz..." - "Ich weiß..." Dikigoros will diese Diskussion nicht noch einmal führen. "Deshalb gibt es hier auch weniger Scheidungen als bei Ihnen. Stimmt es, daß in Amerika und Europa fast jede dritte Ehe geschieden wird?" - "Kann schon sein, wenn die Statistiken das sagen." - "Warum tun die Leute das?" - "Keine Ahnung; meine Frau und ich verkehren nur mit anständigen Menschen," zitiert Dikigoros ihn erneut. (Den boshaften Seitenhieb kann er sich einfach nicht verkneifen.) "Soll das heißen, daß Sie keine Geschiedenen kennen?" - "Doch, aber ich verkehre nicht gesellschaftlich mit ihnen." - "Und wenn sich ein Paar aus Ihrem Bekanntenkreis scheiden lassen würde?" - "Würde ich den gesellschaftlichen Kontakt mit ihm abbrechen." - "Mit beiden?" - "Ja, sicher; an einer gescheiterten Partnerschaft sind immer beide Teile schuld, selbst wenn es im Verhältnis 10:1 ist." - "Dann werden also Geschiedene bei Ihnen auch gesellschaftlich geschnitten?" - "Nicht mehr generell; aber es ist halt so, wenn man selber verheiratet ist, hat man vorzugsweise Kontakt mit anderen verheirateten Paaren; was soll man dann mit Geschiedenen anfangen? Die suchen doch wieder nach einem neuen Partner und bringen damit womöglich Unfrieden in die bestehenden Beziehungen; das muß ja nicht sein."
"Dann lassen sich also bei Ihnen die Leute scheiden, obwohl sie eigentlich verheiratet sein wollen, aber ohne zu wissen mit wem, und gehen dann wieder auf Partnersuche?" - "Ja, das gibt es, ziemlich häufig sogar." - "Das verstehe ich nicht. Wenn jemand zu der Erkenntnis gelangt, daß er oder sie für die Ehe nicht geschaffen ist, na schön, ab ins Kloster, dort kann man ja auch Verdienste erwerben. Und wenn eine Ehe kinderlos bleibt und man glaubt, mit einem bestimmten anderen Partner würde das besser, das könnte ich zur Not auch noch nachvollziehen, obwohl ich nicht glaube, daß solche Fälle sehr häufig sind; aber sich einfach so auf gut Glück scheiden lassen? Und was wird aus den Kindern?" - "Tja, die haben schlechte Karten." - "Wer sorgt für sie, und wer zahlt für ihren Unterhalt?" - "In den meisten Fällen bleiben die Kinder bei der Mutter, und der Mann muß den Unterhalt bezahlen." - "Ist das nicht für den Mann ein schlechtes Geschäft?" - "Das ist für beide Seiten ein schlechtes Geschäft, schon weil es billiger ist, in einem Haushalt zu wohnen und zu essen, als in zwei getrennten Haushalten. Aber Sie haben Recht, daß es für die Männer besonders bitter ist; manchen bleibt von ihrem hart verdienten Geld gerade der Sozialhilfesatz zum Leben, während die Frauen Däumchen drehen oder sich anderweitig verlustieren können. Deshalb gehen heute auch 90% der Scheidungen von den Frauen aus." - "Dann stimmt irgend etwas mit Ihren Gesetzen nicht." - "Da mögen Sie schon Recht haben, aber ich habe sie nicht gemacht. Früher war es umgekehrt, da brauchte der Mann nicht zu zahlen, wenn seine Frau ihn betrogen hatte und schuldig geschieden wurde, da gingen die meisten Scheidungen von den Männern aus." - "Heißt das, daß eine Frau auch dann Unterhalt bekommt, wenn sie ihren Mann betrogen hat?" - "Ja, heute ist das so." - "Warum muß nicht der Mann den Unterhalt bezahlen, mit dem sie ihn betrogen hat?" - "Nur, wenn sie den heiratet, und das tut sie dann natürlich gerade deshalb nicht." - "Was für eine verkehrte Welt! Normalerweise bekommen Huren ihren Lohn doch vom Freier, oder?" - "Den Unterhalt bekommen die geschiedenen Frauen ja nicht dafür, sondern für die Erziehung der Kinder." - "Würden Sie solchen Frauen die Erziehung von Kindern anvertrauen?" - "Nein, aber der Gesetzgeber tut es." - "Was ist das für ein Gesetzgeber?" - "Parteibonzen im Parlament, überwiegend geschiedene Männer."
Kopfschüttelnd widmet sich der gute Mann wieder seinen eigentlichen Aufgaben. Und Dikigoros widmet sich den gut erzogenen Kindern seines Gesprächspartners. "Was möchtet Ihr denn später mal werden, und wo möchtet Ihr leben?" - "In Bãbaī" kommt es wie aus einem Mund. "Und heiraten werde ich auf keinen Fall," ergänzt der Junge, "jedenfalls keine Frau, die mir meine Eltern ausgesucht haben. Und nie wieder Dāl mit Wasser." - "Und jeden Abend Kino," ergänzt seine Schwester. [Nein, liebe Leser, diese Pointe hat sich Dikigoros nicht einfach so ausgedacht. Alles, was er hier und in anderen "Reisen durch die Vergangenheit" an persönlichen Erlebnissen beschreibt, hat so statt gefunden, jedenfalls wie er sich nach bestem Wissen und Gewissen erinnert; und er hat nicht nur ein relativ gutes Gedächtnis, sondern von fast allen seinen Reisen - besonders von denen nach Indien - auch relativ genaue Aufzeichnungen. Die Reihenfolge stimmt nicht immer, dafür hat er zu viele Reisen nach Indien unternommen, die er hier zusammen faßt; er versucht halt, Euch das Interessanteste heraus zu picken und in einen sachlichen, nicht zeitlichen Zusammenhang zu stellen.]
Exkurs. Nachdem Dikigoros hier so viel über Jainen geschrieben hat, mit denen er persönlich zusammen getroffen ist, will er auch noch kurz etwas über ihre Religion und deren touristische Aspekte schreiben, obwohl darüber schon so viele kluge Bücher geschrieben worden sind - leider, wie so oft, viel zu kompliziert und mit der falschen Zielrichtung. Der Jainismus ist, auf einen einfachen Nenner gebracht, eine Mischung aus Hinduismus, Buddhismus und Christentum - auch wenn er lange vor dem letzten entstand, weist er einige erstaunliche Parallelen auf. Sein Gründer - ein mutmaßlicher Zeitgenosse Buddhas - nannte sich "Mahāwīr" (großer Mann, Held), was bis dahin ein Beiname Rāmas gewesen war; und für die damalige Stärke des Jainismus spricht die Tatsache, daß er - anders als Rām und der Buddh - nicht von den Hindūs als Avtar Wishnus vereinnahmt werden konnte. Seine 12 Apostel - erkennbar an den auffallenden Glubschaugen - werden Tirthankaren genannt, Brückenbauer. (Wörtlich übersetzt heißt es "Furtenmacher"; aber Dikigoros nimmt mal an, daß damit das gleiche gemeint ist, und er benutzt den Ausdruck, der seine christlichen Leser daran erinnern soll, daß dies auch der - von den "heidnischen" Römern übernommene - Titel des Bischofs von Rom war und ist; noch heute nennt sich der Papst "Pontifex maximus [oberster Brückenbauer]".) Die Gewaltlosigkeit, welche die Hindūs - allen voran Gāndhī - so gerne für sich als Gesamtheit in Anspruch nehmen, wird eigentlich nur von den Jainen bis zum Extrem getrieben: sie dürfen nicht einmal Insekten in der Luft oder Würmer auf dem Boden verletzen. Nun glaubt freilich Dikigoros - der theologisch vom Jainismus ebenso wenig hält wie vom Buddhismus, bei aller persönlicher Wertschätzung der meisten ihrer Anhänger, die er bisher kennen gelernt hat -, daß der Brauch, immer mit einem Tuch vor dem Mund und einem Staubwedel in der Hand herum zu laufen, ursprünglich viel praktischere und profanere Gründe hatte: Insekten waren oft giftig oder übertrugen Krankheiten; man tat also im eigenen Interesse gut daran, sie nicht zu verschlucken; und auf dem Feld verscheuchte der Wedel schwerlich irgendwelche harmlosen Würmer, wohl aber Schlangen, Skorpione und anderes unangenehmes Getier. Nein, es liegt Dikigoros fern, den Jainen Heuchelei vorwerfen zu wollen; die glauben heute vielleicht wirklich daran, und man soll ja die positive Wirkung von "self-fulfilling prophecies" nicht unterschäzen - aber man muß ihretwegen nicht gleich die Geschichte umschreiben.
![[Tirthankaren - Brückenbauer der Jainen]](tirthankaren1.jpg)
Touristisches? Na klar, Rājasthān ist "in", und fast jeder, der schon mal dorthin gereist ist, hat auch die großartigen Tempelanlagen des Ābū besucht, des höchsten Berges zwischen dem Himālay und dem Nīlgirī, den weißen Bergen des Nordens und den schwarzen Bergen des Südens. Die meisten werden auch mitbekommen haben, daß es sich beim Dilwār-Tempel um ein Heiligtum der Jainen handelt, eines der wichtigsten neben denen in Pālītānā und Shrawan Belgolā, die Dikigoros ja schon kurz erwähnt hatte (die in Khajurāho nicht, aber das will er an dieser Stelle nachholen - sie gehören zu den Tempeln am östlichen Dorfrand.) Warum nur kurz? Weil er meint, daß die viel zu sehr im Mittelpunkt des allgemeinen touristischen Interesses stehen und dadurch den ungleich wichtigeren Blick auf den religiösen Alltag der Jainen verstellen. (Das gilt auch und erst recht für die Jain-Tempel von Ajantā und Elūrā, die nur noch musealen Charakter haben - womit Dikigoros ihnen ihre kunstgeschichtliche Bedeutung nicht absprechen will; aber er ist halt kein Kunsthistoriker und findet das nicht gar so wichtig.) Dabei gibt es so viele weniger große und weniger bekannte Jain-Tempel, die kleine Perlen und einen Besuch allemal wert sind - auch und gerade weil man ihre Standorte meist aus anderen Gründen besucht, also eh schon in der Nähe ist. Wenn Ihr nach Rājasthān fahrt, dürft Ihr Chittaurgarh nicht auslassen, den Schauplatz des heldenhaften Kampfes und Untergangs der Rājputen gegen die Muslime, der mit dem großen Selbstmord der indischen Frauen und Kinder endet, den Dikigoros bereits unter dem Stichwort "Padminī" kurz erwähnt hatte und über den er an anderer Stelle ausführlicher schreibt. Macht Euch frei von dieser närrischen Heldentat, die Euch der Fremdenführer auftischen wird, geht (!) alleine durch die Anlagen auf dem Burgberg (nein, mietet keinen Skutär und auch kein Fahrrad!) und richtet Euer Augenmerk auf die Jain-Tempel! Wenn Ihr nach Udaypur fahrt, vergeßt das blöde Palast-Museum (an dem das beste der Ausblick auf den See mit dem 5-Sterne-Hotel ist; die lieblos zusammen gekramten und schlecht gepflegten Exponate gehören größtenteils auf den Müll - und der Eintrittspreis ist der reinste Nepp!) und geht statt dessen in die Tempel der Stadt, die keinen Eintritt nehmen (obwohl kleine Spenden überall gern gesehen sind :-). In dem der Jainen werdet Ihr die einzigen ausländischen Besucher sein - das ist noch ein echter Geheimtip.
Kein Geheimtip mehr ist dagegen aus gutem Grund der überaus sehenswerte "Kanch Mandir [Spiegel-Tempel]" in Indaur - einer Stadt, die vom Fremdenverkehr völlig zu Unrecht links liegen gelassen wird, sowohl vom inner-indischen als auch und erst recht vom ausländischen; dabei schlägt hier, in der größten Stadt Mālwās (und Madhy Pradeshas) das Herz Indiens vielleicht am deutlichsten. Es ist keine besonders schöne, alte, große oder reiche, keine historisch, wirtschaftlich oder künstlerisch besonders bedeutende Stadt (obwohl sie von allem etwas hat), und dennoch - oder gerade deshalb - ist sie vielleicht die indischte aller indischen Städte, d.h. die, welche für das heutige Leben Bhāratas am typischten ist. Ihr glaubt das nicht, liebe Leser? Hindī lernen (ohne das geht es leider nicht, denn die touristische Infrastruktur ist wie gesagt noch kaum vorhanden, und die Englisch-Kenntnisse der Leute dort sind entsprechend), hinfahren, selber sehen, dann können wir weiter diskutieren. Und noch eine Stadt in Madhy Pradesh wird vom Tourismus viel zu sehr vernachlässigt, für die cum grano salis das gleiche gilt wie für Indaur: Gwāliyar. Wenn Ihr Euch die Mühe macht, zu Fuß um die imposante Festung zu wandern, dann werdet Ihr dort die großartigen Felsskulpturen der Jainen sehen, die einst von den babarischen (kein Tippfehler - Dikigoros nennt sie so nach ihrem Anführer Bābar, dem ersten "Groß-Muģal, der im Westen bis heute unkritisch verherrlicht wird) muslimischen Bilderstürmern zerstört und erst während der englischen Kolonialzeit von den Jainen notdürftig wieder restauriert werden konnten. Ihr solltet sie immer vor Eurem geistigen Auge haben, wenn Euch irgendein wirrköpfiger Traumtänzer, der sich seine Weltanschauung nicht aus der Anschauung der Welt, sondern aus der des staatlichen Fernsehprogramms gebildet hat, etwas von der Möglichkeit eines friedlichen Zusammenlebens zwischen Muslimen und Hindūs in Indien (oder zwischen Muslimen und den Angehörigen irgendeiner anderen Glaubensgemeinschaft in irgendeinem anderen Land der Welt) zu erzählen versucht. Dann braucht Ihr auch nicht mehr nach Somnāth zu fahren, mit dessen Restaurierung die Touristennepper zwar seit einigen Jahren werben, die aber nicht annähernd das zurück gebracht hat - nämlich das größte, schönste und reichste Heiligtum Indiens -, das die Muslime vom 11. bis zum 18. Jahrhundert immer und immer wieder geplündert und zerstört haben. Ihr wäret enttäuscht, denn außer dem unvermeidlichen großen Shiw-Ling mit Tempel gibt es nicht viel zu sehen.
Noch etwas, da wir gerade bei den religiösen Minderheiten Indiens sind: Wie aufmerksame Leser schon an den Untertiteln der Überschrift bemerkt haben werden, wird Dikigoros hier nichts über die Parsen schreiben. Warum nicht? In erster Linie aus praktischen Gründen - die haben ihm halt noch nie die Extrawurst gebraten wie alle anderen Religionsgemeinschaften in Indien und ihn etwa an den Beerdigungsriten teilnehmen lassen, bei denen die Leichen ihrer Verstorbenen den heiligen Geiern zum Fraß vorgesetzt werden. (Dabei hätte er da gar keine Vorurteile; was die Christen tun, nämlich die Leichen ihrer Verstorbenen den Würmern zum Fraß vorzusetzen, findet er um keinen Deut besser; und was einige Hindūs neuerdings aus Geiz praktizieren, nämlich die nicht oder nur halb verbrannten - Holz, zumal Sandalholz, ist nunmal teuer - Leichen ihrer Verstorbenen in den Ganges oder andere Flüsse zu werfen, erst recht nicht.) Er glaubt auch nicht, daß sie es jemals tun werden, schon weil er sich nur ungerne in Bãbaī aufhält - wo die meisten Parsen leben - und daher so bald niemand in die Verlegenheit kommen wird, ihm das anzubieten. Aber wenn Ihr unbedingt auch noch eine theoretische Begründung hören wollt: Die Parsen sind Perser; deshalb gehört die Geschichte ihrer kleinen Diaspora auf indischem Boden nicht in diese "Reise durch die Vergangenheit", sondern in ein anderes Kapitel, nämlich über das alte Persien, das Dikigoros schreiben wird, sobald der verfluchte Islam im Iran ausgerottet ist (denn ihn einfach nur in die Schranken verweisen und auf die Friedfertigkeit der "Gemäßigten" hoffen - die es zumal bei den Shi'iten gar nicht geben darf - wird nicht mehr gehen) und es sich wieder lohnt, hin zu fahren; aber er befürchtet, daß er das nicht mehr erleben wird. Exkurs Ende.
Dikigoros bleibt noch ein paar Tage länger am Ort und erlebt einige sehr interessante Veranstaltungen, u.a. das Sängerfest der Behinderten von irgendwo, die Jahrestagung des Bundesverbandes der Skūtär-Taxifahrer und - ein Treffen der Kashmīr-Exilanten. Sie sind unzufrieden mit der gegenwärtigen Situation: Ihr Land ist in drei Besatzungszonen aufgeteilt: eine pākistānische, eine chinesische und eine bhāratische, so empfinden sie es wenigstens, obwohl eigentlich weder Jammu im Südwesten noch Ladakh im Nordosten richtig dazu gehören. "Und was wollt Ihr?" fragt Dikigoros, Anschluß an China, Pākistān oder Bhārat?" - "Weder noch, wir wollen unabhängig sein, unseren eigenen Staat haben." - "Aber Leute, das ist doch naiv; Ihr könntet Euch weder militärisch zwischen den drei Großmächten behaupten - nicht mal die mächtigen, großen Länder Panjāb und Bengalen konnten das - noch wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen; wovon wollt Ihr denn leben?" - "Vom Tourismus zum Beispiel." - "Was habt Ihr denn touristisch anzubieten außer dem Tal von Shrīnagar, wo inzwischen alles in Trümmern liegt? Felsen, Schnee und die meiste Zeit des Jahres unpassierbare Straßen, Wegelagerer und Touristennepp in schlechten und teuren Hotels und Restaurants, da könnt Ihr lange auf Dumme warten." - "Wir brauchen keine Ausländer, uns genügen die indischen Touristen." - "Ach, Ihr würdet doch sicher ein muslimischer Staat werden - glaubt Ihr im Ernst, dorthin führen noch Hindūs auf Urlaub? Wieviele Bhāratis reisen denn nach Pākistān?" - "Wir sind bereit, materielle Einschränkungen in Kauf zu nehmen; wir wollen nur unsere Freiheit und Selbstbestimmung." - "Freiheit wessen wovon wozu?" - "Unser aller Freiheit von fremden Besatzungstruppen. Um uns selber zu regieren." - "Wollt Ihr wieder selber Soldaten spielen?" - "Ja, gerne." - "Um gegen wen Krieg zu führen?" - "Gegen jeden, der uns angreift." - "Und wenn nun die Kashmīris in Pākistān gar nicht mit Euch wiedervereinigt werden wollen, würdet Ihr auch darum kämpfen?" - "Selbstverständlich, die Gebiete gehören doch dazu!" - "Und die Hindūs in Jammu?" - "Die gehören auch dazu!" - "Und die Tibeter in Ladakh? Die gehören doch nun garantiert nicht dazu." - "Wieso nicht?" - "Weil sie weder Kashmīris noch Muslime sind. Ihr seid doch um keinen Deut besser als diejenigen, die Euch im Moment besetzt haben." Bei solchen vernagelten Typen hört auch bei Dikigoros die Höflichkeit auf.
Szenenwechsel. Wenn sich ausländische Touristen über das berühmt-berüchtigte Dreieck Dillī-Āgrā-Jaypur ["Delhi-Agra-Jaipur"] hinaus trauen, dann reisen sie in den meisten Fällen nach Rājāsthān, womöglich bis nach Jodhpur und Jaisalmer. Warum weiß der Geier, vielleicht entspricht es ihrer Wüsten-Romantik, vielleicht auch nur, weil anderes in der Regel nicht als begleitete Gruppenreise angeboten wird. Jaypur und Udaypur sind längst überlaufene Touristenstädte mit Touristen-Nepp und eigentlich herzlich wenigen Sehenswürdigkeiten: Die Fassade vom "Palast der Winde", der Elefantenritt zum Jaygarh [Siegheilschloß] in Amber, teure Hotels und schlechte Restaurants - wen, der sich etwas besser in Indien auskennt, kann das reizen? Wenn Dikigoros nach Rājāsthān fährt, dann nach Bharatpur, der alten Hauptstadt der Jaten, und zum idyllischen Naturschutzpark Kevladev ["Këuladëu"]. Er steigt wohlweislich nicht in dem häßlichen, teuren Schuppen mitten drin ab, der aus unerfindlichen Gründen 5 Sterne hat, sondern in einem der kleinen Privat-Hotels an der Straße davor. (Von dort kommt man übrigens auch viel besser - und billiger - in die "Geisterstadt" Fatähpur Sikrī als von Āgrā.) Die Ecke ist zwar nicht offiziell für den Autoverkehr gesperrt, aber de facto gibt es trotzdem kaum welchen; vom ca. 8 km entfernten Bahnhof (wo nur 1-2x am Tag ein überregionaler Expreß hält) verkehren nur Fahrrad-Rikshen - die auch als einzige die Lizenz zum Fahren innerhalb des Parks haben. Bis auf ein paar unverbesserliche Vogelfreunde, die irgendwelches seltene Federvieh beglotzen wollen, trifft man hier keine Ausländer, und erstere werden auch gleich ordentlich geschröpft. Bewahre, nicht weil sie Ausländer sind - anders als in anderen asiatischen Ländern kostet der Eintritt zum Nationalpark an sich für sie nicht mehr -, man regelt das viel subtiler: Das Entgelt für die Mitnahme von Foto- und Film-Kameras verzehnfacht sich, wenn man ausländische Fabrikate benutzt. "Aber gewiß doch," wenn Sie eine indische Kamera mitbringen, zahlen Sie auch als Ausländer nur ein Zehntel," sagt der Kassierer auf Befragen, "und umgekehrt, wenn ein Inder sich eine teure ausländische Kamera leisten kann, zahlt er das zehnfache." Wie gut, daß Dikigoros überhaupt keine Kamera mit hat - so dreht er diesem Nepp eine Nase; bedenklich findet er ihn dennoch. Früher war dies das Jagdrevier irgendeines Rājās und seiner Gäste; ein verwitterter Gedenkstein inmitten des Parks zeugt von den glorreichen Abschuß-Rekorden irgendwelcher Briten, die hier noch kurz vor ihrem Abzug fast die Wildenten ausgerottet hätten.
Aber nicht nur im Park gibt es komische Vögel. Dikigoros hat sich zielsicher dasjenige Hotel ausgesucht, in dem auch Einheimische mit Gespür für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verkehren. Abends trifft sich eine Gruppe junger Nationalisten - keineswegs konspirativ, sondern ganz offen - zu einer Garten-Party, und Dikigoros wird ohne weiteres mit eingeladen. Es stehen mal wieder Wahlen bevor (in Bhārat stehen fast immer irgendwo irgendwelche Wahlen bevor, das bringt ein großer Bundesstaat so mit sich), und die jungen Männer sind Anhänger der BJP [Bhāratische Volkspartei], die damals noch nicht an der Macht ist, sondern von vielen Polit-Gurus - vor allem im Ausland - als "faschistisch" beschimpft wird. Im Zug hierher sind ihm schon die Fahnen schwenkenden Wahlkämpfer der Daliten aufgefallen, die sich auf Dr. Ambedkar berufen, den ersten Shudr, der es (unter Nehrū) zum Minister brachte, und auf den Buddh, weil der angeblich die Kasten abschaffen wollte. "Diese Neo-Buddhisten sind doch Betrüger," sagt einer der jungen Männer auf Befragen, "sie sprechen von Gleichheit und Gemeinsamkeit; aber die kann doch nur im nationalen Rahmen erreicht werden, nicht indem wir wieder irgendwelche religiösen Sekten hervor kehren. Das ist ja gerade das Übel Indiens, die Feindschaft zwischen Hindūs, Muslimen, Christen, Parsen und jetzt auch wieder Buddhisten. Die muß überwunden werden." - "Meinen Sie wirklich, daß sich die Feindschaft zwischen Muslimen und anderen Religionen so einfach überwinden läßt?" - "Nicht so einfach; aber man muß die Muslime halt auf ihr Privatleben verweisen und darf nicht zulassen, daß sie Religion mit Politik vermengen." - "Aber das ist doch gerade der Inhalt des islāmischen Glaubens, daß öffentliches und privates Leben nicht von einander zu trennen sind." - "Das sehen andere anders. Wer darauf besteht, muß gehen." - "Wohin? Wollen Sie nicht Pākistān heim ins Reich holen?" [Dikigoros hat seine Hausaufgaben gemacht: "Ek Rāshtr", ein Reich, lautet die Parole der Volkspartei, über die er an anderer Stelle mehr schreibt.] - "Nun, das sind doch auch Inder wie wir, warum sollen die in einem separaten Staat leben, unter einem totalitären Militär-Regime, das ihnen keine Religionsfreiheit gewährt? Unsere Regierung ist viel zu schlaff, gibt immer wieder nach, auch in Kashmīr; der Kongress hat abgewirtschaftet, ist zu lange an der Macht..."
"Hat nicht die Kongress-Partei, als sie an der Regierung war, mehrere Kriege gegen Pākistān geführt, auch und gerade um Kashmīr?" - "Ja, aber immer nur halbe Sachen. Pākistān hat keine Existenz-Berechtigung; wir müssen es zerschlagen, bevor es zu stark wird. Die Amerikaner haben es wahrscheinlich schon mit Atombomben ausgerüstet, aber noch sind sie schwach." - "Wohl immerhin stark genug, um Euch ein paar von den Dingern aufs Haupt zu werfen, jedenfalls im Westen, sagen wir mal auf Dillī, Ahmädābād, Bãbaī, Punä..." - "Das werden sie nicht tun, denn gerade dort leben große muslimische Minderheiten. Und wenn sie es täten, umso besser, und meinetwegen auch gleich auf die Muslim-Hochburgen Haidärābād und Kalkattā. Sie müssen nicht glauben, daß wir auf die paar Städte unbedingt angewiesen wären. Das ist nicht wie bei Ihnen im Westen. Das wahre Indien, das wir wieder beleben müssen, ist auf dem Land, wie hier, in den Dörfern." - "Wo werden denn Ihre Raketen entwickelt und die Software, um sie zu bedienen? Auf dem Dorf oder nicht doch eher in Bangalūr?" - "Städte arbeiten nicht, sondern Menschen. Was Menschen in Städten tun können, könnten sie ebenso gut oder besser in kleinen, intakten Dorfgemeinschaften tun. Glauben Sie nicht?" - "Hm... das hat Gāndhījī auch immer gemeint - und was ist daraus geworden? Sie sind seit einem halben Jahrhundert selbständig; glauben Sie wirklich, daß Indien heute weiter ist als es unter den Engländern wäre?" Sein Gesprächspartner wird rot. "Damals waren wir noch nicht geboren," sagt ein anderer, "woher sollen wir das wissen? Außerdem kann das niemand sagen." - "Ihr redet immer vom Krieg. Habt Ihr gedient?" fragt Dikigoros, der wie immer seine Militär-Uniform trägt. "Das nicht, aber wir würden uns sofort freiwillig melden, wenn ein Krieg ausbricht." - "Ohne Ausbildung?" - "Wir sind Jaten, aus der Kriegerkaste der Siηh, uns liegt das Kämpfen im Blut; wir brauchen keine Ausbildung zum Paradesoldaten."
"Die Kriege von heute werden nicht mehr mit Säbel und Schießgewehr ausgetragen," sagt Dikigoros, "Ihr wäret bloß Kanonenfutter und in den ersten paar Wochen verheizt, wie die jungen Deutschen im Ersten Weltkrieg, die sich 1914 direkt von der Schulbank freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet haben und bei Langemarck ins Feuer der englischen Maschinen-Gewehre gelaufen sind. Wart Ihr mal in Kashmīr?" - "Das ist die Perle Indiens und muß es unbedingt bleiben." - "Perlen vor die Säue. Wollt Ihr wirklich Euer Leben einsetzen für ein Land, in dem 95% der Bevölkerung Muslime sind und nichts von Euch wissen wollen?" - "Man muß sie eben wieder zum Hindutva bekehren." - "Na, viel Spaß. Wie viele bekehrte Muslime kennt Ihr?" - "Keine, die bringen ihre Leute ja immer gleich um, wenn sie konvertieren." - "Eben," meint Dikigoros trocken, als der Strom ausfällt. Das Hotel-Personal bringt Kerzen. "Ihr wollt einen modernen Krieg mit Atomraketen führen und bekommt nicht mal Eure Stromversorgung in den Griff. In den großen Städten will ich ja nichts sagen, wenn ab und zu mal ein Blackout ist; aber hier auf dem Lande, im wahren Indien?" - "Wir brauchen gar keinen Strom," sagt einer der jungen Jaten trotzig, "wir trinken ja auch kein eisgekühltes Bier." (In der hintersten Ecke des Hotelgartens hat der Inhaber einem Grüppchen australischer und niederländischer Vogelfreunde einen separaten Tisch aufgestellt; die zahlen für zwei Dosen Heineken-Bier aus der Kühltruhe soviel wie Dikigoros für eine Übernachtung, wohlgemerkt im selben Haus, d.h. sie subventionieren gewissermaßen Dikigoros' Hotelzimmerpreis - der frei ausgehandelt ist; die anderen Ausländer zahlen erheblich mehr, und die Einheimischen vielleicht noch etwas weniger. Aber da ist er sich mit dem Inhaber einig: Man kann sich seine [Mit-]Gäste nicht immer aussuchen, und Geld stinkt nicht, zumal es nicht bei zwei Dosen Heineken bleibt. Dikigoros muß an Peter Schmid und das Bier in Rourkela denken :-) "Ich auch nicht; aber wie würdet Ihr z.B. Euren Tee kochen ohne Strom, könnt Ihr mit einem Holzkohleherd umgehen, oder habt Ihr alle einen Esbit-Kocher?" - "Einen was?" - "Ach so, Ihr habt ja nicht gedient. Wißt Ihr überhaupt, wie es auf einem Dorf zugeht, wo es abends kein elektrisches Licht gibt und auch keine teuren Wachskerzen? Woher kommt Ihr denn?" - "Na, hier aus Bharatpur." - "Eben."
Ja, die Feindschaft zwischen Hindus und Muslimen, zwischen Bhārat und Pākistān, aber auch zwischen den "Communities", wie die religiösen Gemeinden in Bhārat genannt werden, ist das eigentliche Problem Indiens. Nicht die Übervölkerung, nicht der Hunger, nichts von all den anderen Problemchen, die von oberflächlichen ausländischen Reisenden - auch von so genannten "Experten" und "Wissenschaftlern" (aber auch von indischen Politikern, wenn sie vor westlichen Mikrofonen und Fernseh-Kameras sprechen) - für gewöhnlich in den Vordergrund geschoben werden. Wobei man sich nicht wundern darf, daß sich die Ausländer - angefangen schon bei den Briten zur Kolonialzeit - ein schiefes Bild machen, zugunsten des Islām und zulasten des Hindutva: Alles, was sie "Schönes" und "Großartiges" sehen ist - oder gilt als - muslimisch, vom Tāj Mähäl bis zum Amber-Palast, vom "Palast der Winde" bis zum Wasserschloß in Udaypur. Alles Negative - oder als negativ empfundene - dagegen wird auf das Konto des Hinduïsmus gebucht, einschließlich der verrückten westlichen Hippies und Junkies, die einige "spirituelle" Orte Indiens erst zu dem gemacht haben, was sie heute sind (Warānsī mal ausgenommen, das wohl schon immer so war wie es ist). Aber wer stößt schon in die nicht-muslimischen Gegenden Indien vor, ja, wer reist überhaupt weiter südlich als bis Bãbaī? Und wenn, dann entweder ins völlig verwestliche Gowa, nach Maisūr (auch der dortige Sultans-Palast ist - natürlich - ein Werk der Muslime) oder neuerdings auch nach Keral - das übrigens bei weitem nicht so attraktiv ist, wie es von einigen Reiseveranstaltern gemacht wird. Und was erzählt man den tumpen Touristen dazu? Keralas Ruhe und Beschaulichkeit resultiere in erster Linie aus einem gelungenen Multi-kulti-Experiment: Die einzigartige Verschmelzung hinduïstischer, muslimischer und christlicher Lebensformen, blablabla... Wenn Ihr das glauben wollt, liebe Leser, dann fahrt besser nicht hin, um Euch diese schöne Illusion zu bewahren, oder nur mit einem europäischen Reiseveranstalter, der Euch in einer gut abgeschirmten Touristen-Enklave von Einheimischen fern hält, die Euch womöglich etwas ganz anderes erzählen könnten. Nein, Dikigoros ist kein großer Freund der Malābār-Küste. [Wenn Ihr darüber etwas lesen wollt, dann besorgt Euch "Als die Welt noch offen war", die Reisememoiren von Katharina Zitelmann, die dem "indischen Musterstaat" Keral - oder, wie er damals noch hieß, Travancore -, jenem "Garten Eden", eine Liebeserklärung von mehr als 100 Seiten widmet; vielleicht war es das damals, vor dem Ersten Weltkrieg, noch wert. Wenn Dikigoros irgendwann mal dazu kommt, Das Reich, in dem die Kugel rollte zuende zu schreiben, wird er darauf vielleicht noch etwas ausführlicher zurück kommen.] Auch nicht des Hinterlandes, weder der "Backwaters" noch der "Blauen Berge" (er versteht nicht, was die Leute am "Nilgiri"-Tee finden - er betrachtet ihn als eine der schlechtesten Provenienzen Indiens); er zieht die Koromandal-Küste und deren Hinterland vor, mit den großartigen Tempelanlagen Tamil Nādus, in Madurai, Tiruchirapalli, Māmallapuram usw., und natürlich der vorgelagerten Insel der Seligen, Serend[w]ip, Shrī Lankā, Ceylon, oder wie immer Ihr sie nennen wollt. Aber was die angeht, so will sich auch Dikigoros seine Illusionen bewahren, genauer gesagt die, daß ein friedliches Zusammenleben zwischen hinduïstischen Tamilen und buddhistischen Siηhalesen möglich ist, denn er hat die Insel 1982 kennen gelernt, vor Ausbruch des Bürgerkriegs; und dieses Bild aus seiner Erinnerung will er sich nicht zerstören lassen.
Nachtrag. Aber Ihr, liebe jüngere Leser, die Ihr das alte Ceylon nicht mehr kennen gelernt habt, dürft selbstverständlich hin fahren, zumal der Bürgerkrieg nun endlich vorbei ist. Ja, es ist die Zeit der Nachträge. 2009 gelang es den Siηhalesen, die "Tamil Tigers" vollständig zu besiegen; und obwohl - oder gerade weil - Dikigoros für beide Seiten ein gewisses Verständnis hat, hat er bis heute nicht verstanden, warum dieser fast 26-jährige (wenn man die ersten schweren Unruhen in Jaffna mit zählt, sogar fast 28-jährige) Bürgerkrieg geführt wurde. Vielleicht könnt Ihr es ihm erklären, wenn er Euch ein paar Eckdaten mit auf die Reise gibt (die in den meisten westlichen Medien entweder ganz verschwiegen oder aber in ein paar Dreizeiler auf der vorletzten Seite verbannt wurden): Über die Jahrhunderte hinweg mußten die Siηhalesen - wenn man ihren Chroniken glauben darf, und Dikigoros ist geneigt, das zu tun - immer wieder Invasionen durch Tamilen vom indischen Festland über sich ergehen lassen, die sich im Norden der Insel festsetzten und dort bald die Mehrheit bildeten. Das wäre nicht gar so schlimm gewesen, wenn nicht auch noch die britischen Kolonialherren einen weiteren Schub Tamilen ins Land gebracht hätten, als Arbeitskulis für ihre Plantagen, was den Bevölkerungsanteil der Siηhalesen auf ca. 70% drückte. Als diese 1948 unabhängig wurden, begannen sie die Tamilen Schritt für Schritt zu diskriminieren; 1970 machten sie Siηhalī zur alleinigen Amtssprache und den Buddhismus zur Staatsreligion. Als sie sich zwei Jahre später zur "Republik Shrī Lankā" erklärten, wollten auch die Tamilen ihren eigenen Staat aufmachen: Tamil Eelam. Da man sie nicht ließ, sondern ihre dieses Ziel verfolgende Partei für illegal erklärte, gingen ihre "Freiheitskämpfer", die "Tamil Tigers", in den Untergrund. Dort sah man erstmal nichts von ihnen; und Dikigoros gewann damals den Eindruck, daß die beiden Völker auf Ceylon sich zwar nicht sonderlich liebten, aber auch nicht gleich mit Waffen auf einander los gehen würden. Doch der Konflikt schwelte weiter; und 1983 eröffneten die "Tiger" den offenen Kampf gegen die siηhalesische Armee, die sie als "Besatzer" empfanden. Die Siηhalesen reagierten mit harter Hand; 150.000 Tamilen wurden vertrieben (oder flohen - die Terminologie ist unerheblich, denn das Ergebnis bleibt sich gleich) in das Land ihrer Vorfahren, Tamil Nadu. Dort machten sie es wie die aus Judäa und Samaria vertriebenen Palästinenser: Sie bildeten ihre jungen Männer (und auch einige Frauen) zu Terroristen aus, die dann in ihre Heimat Nordceylon zurück kehrten und dort Anschläge verübten. Nach ein paar Jahren einigten sich Shrī Lankā und Bharat auf ein gemeinsames militärisches Vorgehen gegen die "Tamil Tigers" - war das Verrat seitens der indischen Regierung? Man kann es so sehen, und die Tamilen sahen es so; und nun brach sich wieder der alte Konflikt Bahn zwischen den Südindern - die sich als die "echten" Inder betrachten, weil der Norden doch Jahrhunderte lang von den Muslimen beherrscht wurde - und den Nordindern - die sich als die "echten" Inder betrachten, weil im Süden doch bloß diese dunkelhäutigen Drawiden leben, und die Tamilen sind die dunkelsten von allen. Nun standen die in Nordceylon verbliebenen Tamilen plötzlich wie ein Mann hinter den "Tigern", die bis dahin nur eine radikale Splittergruppe mit eher geringem Zulauf waren. Binnen drei Jahren jagten sie das indische Expeditionskorps ("Friedenstruppen" genannt - das kennen wir heute ja zur Genüge auch aus anderen Teilen der Welt, inzwischen sogar mit deutscher Beteiligung) und die siηhalesische Armee zum Teufel, und dazu gleich noch rund 100.000 Muslime, die von früher übrig geblieben waren. Das war bewundernswert, und vor allem für letzteres gebührt ihnen unser aller Dank, auch jener der Siηhalesen. Aber dabei beließen sie es nicht, sondern gingen zum Gegenangriff über: Mit Selbstmordanschlägen - ebenfalls nach Art der Palästinenser - töteten sie erst den Premier-Minister von Bhārat (Rajīw Gāndhī, den Enkel Nehrūs), dann den Präsidenten von Shrī Lankā (Ranasiηh Premadasa).
Moment mal, schreibt Dikigoros nicht immer von der Friedfertigkeit der indischen Religionen, des Hinduïsmus und des Buddhismus? Tja, liebe Leser, das ist die Theorie; aber in der Praxis gibt es halt Ausnahmen; und wenn Ihr Euch entschließt, die Forsetzung dieser "Reise durch die Vergangenheit" zu lesen, dann werdet Ihr erfahren, daß diese "Ausnahmen" immer häufiger werden. Doch vorerst scheint der Friede doch noch auszubrechen: 2002 wird ein Waffenstillstand geschlossen, mit dem Shrī Lankā de facto die Unabhängigkeit von "Tamil Eelam" anerkennt. Dabei hätte es bleiben können, zumal sich die "Tiger" 2004 spalten: Ein Teil will den Kampf gegen die Siηhalesen noch weiter führen; aber es fehlt an Geld, um eine ausreichende Menge Waffen und Munition für eine Offensive zu kaufen; und die Mehrheit der Tamilen ist mit dem Erreichten zufrieden. Die ersten Touristen kehren zurück - Dikigoros nicht, denn inzwischen sind seine alten Briefkontakte, sowohl zu den Siηhalesen als auch zu den Tamilen, abgerissen; aber andere, z.B. der bundesdeutsche Ex-Kanzler Kohl, lassen es sich wieder wohl ergehen in einigen ausgesuchten Luxus-Enklaven der einstigen Insel der Seligen. Doch dann, Weihnachten 2005, kommt nach einem Seebeben die große Flutwelle, und die überspült auch ein paar Fischerhütten an der Nordostküste Ceylons. Na und? Ist das ein Grund, den Bürgerkrieg wieder aufzunehmen? Eigentlich nicht - im Gegenteil, jetzt gäbe es doch wichtigeres zu tun: Wiederaufbau und so. Aber da sind ja noch die westlichen Gutmenschen, die das dringende Bedürfnis verspüren, den armen "Tsunami"-Opfern auf Ceylon zu helfen, ohne Ansehen von Rasse, Religion und/oder politischer Überzeugung. Die Spendengelder sprudeln; und die "humanitären Helfer" wollen sie - aus Angst vor Mißbrauch und Veruntreuung - gleich persönlich abliefern; aber die Regierung in Colombo stellt sich quer, mit der absurden Unterstellung, damit würden die "Tiger" nur Kriegsgerät kaufen und den Kampf wieder aufnehmen. Ein Aufschrei der massenmedialen Empörung geht um den Globus, und nach allseits massivem internationalem Druck mußte Shrī Lankā nachgeben. Was geschieht? Richtig geraten, liebe Leser: Die "Falken" unter den "Tigern" tun mit den Hilfsgeldern genau das, was die Regierung vorher gesagt hat. (Und die Rüstungsbetriebe überall auf der Welt freuen sich klammheimlich: Wieder ein Absatzgebiet mehr für ihre Produkte - es gibt ja noch nicht genug Kriege!) Die Tiger nehmen den Bürgerkrieg wieder auf, tragen ihn mitten in siηhalesisches Gebiet, bis nach Colombo, zerstören den Flughafen der Hauptstadt und ermorden den Außenminister; auch der Führer der nicht-militanten Tamilen, Thamilselwan, kommt um - wie genau, weiß man bis heute nicht, jeder gibt dem anderen die Schuld. Aber irgendwann sind die Spendengelder aufgebraucht, und die siηhalesischen Truppen gehen zum Gegenangriff über. Diesmal nehmen sie keine Rücksicht mehr auf Zivilunken; und Gefangene werden sowieso nicht gemacht. Im Dezember 2008 fallen die letzten ernst zu nehmenden militärischen Stützpunkte der "Tiger"; 2009 geht der Kampf zuende. Ihr könnt stolz sein, liebe Gutmenschen und auch Ihr, liebe Narren, die Ihr Geld für die vermeintlich "gute Sache" gegeben habt: Jeder von Euch gespendete Geldschein hat schätzungsweise ein Menschenleben gekostet; an Euren großzügigen Fingern klebt das Blut 'zigtausender Menschen. (Auch in Aceh, wo die schon eingeschlafenen Kämpfe prompt wieder aufgeflammt sind, nachdem genügend Geld ankam, um Waffen und Munition nachzukaufen, und in Somalia, wo sich die armen Piraten endlich ordentliche Schnellboote und Kanonen kaufen konnten, um auch größere Frachter und Öltanker am Golf von Aden zu überfallen - aber das sind zwei andere Geschichten.) Ihr seid also nicht nur Narren, sondern auch Beihelfer zum Massenmord, denn Ihr hättet es wissen müssen. Einige von Euch meinen vielleicht, daß es nicht schade wäre, sind ja bloß tote "Inder", und von denen gibt es bekanntlich mehr als genug, ca. 1 Milliarde... Aber wißt Ihr, wie viele Tamilen es noch gibt am Ende des Bürgerkriegs? 40 Millionen - in Tamil Nadu. Nachtrag Ende.
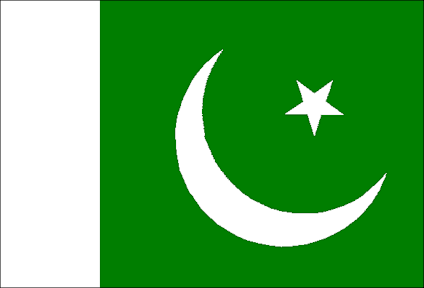
Da wir eben bei Pākistān waren: Dikigoros hat auch den pākistānischen Teil des Panjāb besucht, genauer gesagt die ehemalige Kaiserstadt Lāhaur, den Geburtsort seines alten Gurus (aber er erzählt ihm nichts davon, es wäre zu deprimierend). Entgegen seiner Gewohnheit steigt er nicht in einem Hotel für Einheimische ab (er mißtraut den Muslimen), sondern in einem zwielichtigen Gasthaus, wo sich ausländische Rucksack-Reisende treffen - der Name tut nichts zur Sache, denn der wird alle paar Jahre geändert, wenn sich die Warnungen wieder herum gesprochen und ihren Weg in die Neuauflagen der Reiseführer gefunden haben. (Unter der neuen Farbe kann man noch die alten Namen durchschimmern sehen. Für Insider: zu seiner schlimmsten Zeit war es nach einem Beatle benannt.) Kaum ist er eingecheckt, als er schon Besuch bekommt: Ein schmieriger Einheimischer fragt, ob er gerne Bier trinke. "Nein, wieso?" - "Ausgezeichnet, dann können Sie doch morgen mit mir zur Behörde gehen, sich ein Alcohol-Permit für Ausländer holen und mir das Bier verkaufen." - "Ja, ja, morgen." Dikigoros tut es wirklich, aus Neugierde, sein Begleiter bezahlt die Stempel-Gebühr, und es funktioniert tatsächlich (er hat den kuriosen Alkohol-Bezugserlaubnis-Stempel - von der Größe eines Visums - bis heute in seinem alten Paß, den er just aus diesem Grunde aufbewahrt). Er besichtigt die Stadt, von der ganze Generationen früherer Reisender aus aller Welt nur in den höchsten Tönen geschwärmt haben. Was ist geblieben von all dem Glanz? Nichts als Dreck und Staub, Ruinen und verschleierte Frauen. Nein, dieser Glanz kann nie von den Muslimen ausgegangen sein, die dort geherrscht haben; der Islām hat immer und überall auf der Welt nur von älteren Kulturen schmarotzt, die er eroberte und ausplünderte, und deren restliche Substanz er früher oder (in wenigen Fällen) später verfrühstückt hat; am Ende blieben immer Hunger und Armut zurück. Nur in den protzigen Moscheen sammelt sich ein letzter Rest Wohlstand - von dem freilich niemand abbeißen kann.

Kaum ist Dikigoros wieder im Gasthaus, bekommt er erneut Besuch, von einem Amerikaner aus dem Zimmer nebenan, der wahrscheinlich nicht viel älter ist als er selber, aber aussieht wie sein eigener Großvater: Ausgezehrt und abgemergelt, wie ein Rauschgiftsüchtiger halt aussieht. Er tischt ihm gleich eine rührselige Geschichte auf: Er sei Geschäftsmann und hier zum Einkauf von irgendwelchem Krimskrams her gekommen, aber vor Jahr und Tag krank geworden und seitdem an dieses Gasthaus gefesselt; die Betreiber ließen ihn hier wohnen und versorgten ihn notdürftig, dafür luchsten sie ihm allmonatlich ein Alcohol Permit ab, mit dem sie auf dem Schwarzmarkt gute Geschäfte machten. Die Ärzte taugten nichts, sie ließen ihn nicht alleine fort gehen, und in seinem Zustand traute er sich eh nicht alleine nach draußen, dabei würde er so gerne mal wieder ordentlich essen gehen, um zu Kräften zu kommen, blablabla... "Kennst du denn ein ordentliches Restaurant hier?" - "Ja, ein chinesisches." Das klingt gut, Dikigoros läßt sich breit schlagen und begleitet "John" (wenn er denn wirklich so heißt, er kann es nicht nachprüfen, denn seinen Pass hat ja der Hotelier) in die Innenstadt. Nein, John macht keine Anstalten, seine Botschaft oder sein Konsulat anzurufen (was nicht gerade für den Wahrheitsgehalt seiner Geschichte spricht, daß er gegen seinen Willen hier festgehalten und seine "Krankheit" ausgenutzt werde, aber Dikigoros hakt nicht nach). Das Essen im chinesischen Restaurant ist o.k., auch der Tee; nachdem beide doppelte Portionen verdrückt haben, schleichen sie (John ist nicht gut zu Fuß) zurück ins Gasthaus, als es schon dunkel wird. Am Straßenrand, vor allem auf den Brücken, hocken jetzt zwielichtige Figuren, "Bettler" mit langen Stöcken. John kauft ihnen den Weg frei mit "milden Gaben", d.h. Aluchips; Dikigoros steht finsteren Blickes daneben und schlägt demonstrativ mit der armlangen, eisernen Stabtaschenlampe (die mit sich zu führen ihm niemand verbieten kann - es ist ja keine Waffe, ebenso wenig wie die Stöcke der "Bettler"), die, mit schweren Batterien gefüllt, mehrere Kilo wiegt, in seine linke Hand; wenn eine dieser dürren Gestalten es wagte, ihm zu nahe zu kommen, würde ein Schlag auf den Kopf (er überragt sie allesamt mindestens um Hauptes Länge) genügen, um sie zu töten; und Dikigoros hätte überhaupt keine Skrupel: Er hat schon zu viele Tote gesehen auf dem indischen Halbkontinent, und jeder tote Muslim ist ein guter Muslim. Punkt.
![[pakistanische Aluchips]](pakistanbettelpaise.jpg)
Als sie wieder im Gasthaus ankommen, wartet schon die nächste Hilfesuchende, aus dem Zimmer schräg gegenüber: Eine Französin. Sie wohnt hier mit einem Jammerlappen von Landsmann, der rauschgiftsüchtig ist und gerade "unter Strom" steht. Das scheint ihr nichts auszumachen, denn er liegt ja bloß irgendwo in der Ecke herum; aber auf ihrem Zimmer haben sich - es gibt keine richtigen Schlösser, jedenfalls keine, die man von innen verschließen könnte - vier einheimische Männer versammelt, zu einem durchaus "freundschaftlichen" Besuch, und die machen keinerlei Anstalten, zu gehen. Auch die Französin - die sich "Yvette" nennt - tischt Dikigoros gleich eine rührselige Geschichte auf, ganz glücklich, einen vermeintlichen Landsmann gefunden zu haben (er läßt sie in dem Glauben): "Früher haben wir die Tour öfter gemacht, haben hier billig Drogen eingekauft und nach Europa geschmuggelt, dort mit Gewinn verkauft und Alkohol zurück gebracht. Wissen Sie, was eine Flasche echter Johnny Walker hier bringt?" Nein, das weiß Dikigoros nicht, es ist ihm auch ziemlich egal. "Nach ein paar Jahren hat er selber angefangen, das Zeug zu nehmen, und die Geschäfte liefen nicht mehr so, es ging ja dann nicht mehr über Land, und an den Flughäfen kontrollieren sie immer strenger; wir wären fast mal erwischt worden, und das Risiko, hier in einem Gefängnis zu landen, wollten wir nicht eingehen. Ich habe angefangen zu tanzen, das hat anfangs sehr gutes Geld gebracht; die sind hier ganz verrückt nach Frauen, besonders nach Europäerinnen. Aber mit der Zeit..." Ja, man sieht ihr den Zahn der Zeit an, der an ihr genagt hat; sie ist vielleicht um die 30, könnte aber auch für wesentlich älter durch gehen. Sie hat sich ganz professionell zurecht gemacht - für pākistānische Männer ist das schon die reinste Strip-show, wie sie da, gut geschminkt und nur in ihr Badetuch gehüllt, auf dem Bett sitzt. Sie bemerkt Dikigoros' kritischen Blick. "Draußen trage ich natürlich die Tracht der einheimischen Frauen." - "Auch einen Schleier?" - "Sogar einen Chādar [das ist das, was im Westen meist "Tschador" geschrieben wird, Anm. Dikigoros]. Je me débrouille." - "Und dieses Leben macht Ihnen nichts aus?" - "Man gewöhnt sich dran. Früher haben wir in den besten Hotels logiert; aber nun... Man hat uns hier einen Vorzugspreis für Dauergäste gemacht, wissen Sie, deshalb kann ich die Leute nicht so ohne weiteres hinaus werfen; ich glaube, die zahlen Eintritt dafür, daß sie mich sehen dürfen." - "Na, mich aber nicht," sagt Dikigoros und komplimentiert die Viererbande höflich, aber bestimmt hinaus. "Sie können Urdū?!" - "Nein, aber Hindī, gesprochen ist das fast das gleiche." - "Ich weiß," sagt sie und offenbart, daß auch sie ein paar Brocken kann. "Sind Sie mit dem da verheiratet?" fragt Dikigoros, wieder auf Französisch. "Nein," lügt sie, "Sie reisen alleine?" - "Nein, "lügt Dikigoros zurück, "meine Frau ist schon mal nach Delhi voraus gefahren." Sie läßt enttäuscht den Blick sinken; Dikigoros geht auf sein eigenes Zimmer und verrammelt die Tür. Am nächsten Morgen fährt er zurück nach Dillī.
![[Dilli - Hindi-Schreibweise für Delhi]](dilli.jpg)
weiter zu Teil IV
zurück zu Teil II
heim zu Reisen durch die Vergangenheit